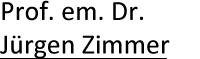Jürgen Zimmer: Biografische Fragmente -
auf den Souren eines abenteuerlichen Wissenschaftlers -
fast ein Interview
David Becker:
Du vertrittst eine Pädagogik, in deren Mittelpunkt das Leben und der Umgang mit der Wirklichkeit stehen. Nun bist du Professor und bringst anderen diese Pädagogik bei. Wie hältst du es mit dem »Lernen in der Wirklichkeit«, in der Wirklichkeit deiner Lehre?
Jürgen Zimmer:
Es hat in meinem Leben als Hochschullehrer zwei Möglichkeiten gegeben, Wirklichkeit auf eine andere Weise in Erfahrung zu bringen als in Seminarräumen: einerseits in meiner journalistischen Rolle, weil ich dann recherchierte und draußen war und mit anderen Personengruppen und Sachverhalten zu tun hatte, und eben mit Aktionsforschungsprojekten, in denen ich mit vielen Menschen zusammenkam, die jenseits des akademischen Milieus standen. Vor allem auch durch meine Arbeiten in der südlichen Hemisphäre — meist an sozioökonomischen Peripherien — bekam ich unmittelbaren Kontakt mit der Bevölkerung. Das heißt, meine eigenen Momente der Glückseligkeit liegen in solch unmittelbaren Projektzusammenhängen, wenn ich mich – sagen wir mal – am Smokey Mountain, dem rauchenden Müllberg von Manila, mit der Gründung einer produktiven Schule beschäftige, das sind unmittelbare Erfahrungen.
Dann sage ich mir, dass dies lernintensiv auch für Studentinnen und Studenten sein kann. Ich habe sie deshalb immer wieder mitgenommen in die Länder des Südens, ich habe sie nicht vorbereitet bis in die letzten Details einer üblichen Exkursion und auch nicht darauf, was ihnen da alles widerfahren kann, sondern sie ziemlich unmittelbar dem extremen Setting ausgesetzt. Mit anderen Worten: Sie kommen in Manila an am Flughafen, sind einen Tag später in den Slums und leben mit diesen Menschen. Da beginnt dann das intensive Lernen. Ich sage ihnen noch, was man vielleicht gesundheitlich beachten muss, aber ich erkläre ihnen nicht wie ein Kulturanthropologe zwei Semester lang, was alles zu bedenken ist. Solche Projekteinsätze können bei den Beteiligten deutliche biografische und auch wissenschaftliche Spuren hinterlassen. Das haben sie mir bei späteren Treffen immer wieder berichtet. In der Universität hat das in meinen Veranstaltungen zu einem Zulauf von Studieren-den geführt, die merken, dass eine Tür zu einer interessanten Wirklichkeit geöffnet wird und dass der ständig reklamierte Theorie-Praxis-Bezug hier in einer eher ungewöhnlichen Weise beantwortet wird.
Eine anderer Punkt ist, dass ich keine Lust habe, ein pädagogisches Muster des 19. Jahrhunderts zu reproduzieren, dass man sich nämlich jede Woche für anderthalb Stunden trifft, Papiere über den Tisch schiebt und Frontalunterricht praktiziert, sondern wir haben – mit ähnlich denkenden Kollegen – andere Formen gefunden. Ich veranstalte Seminare so, dass ich sie vier oder fünf Sitzungen anlaufen und sie später in Konferenzen münden lasse, bei denen sich die
Studierenden über zwei Tage intensiver kennen lernen, und ich bestücke diese Konferenzen auch mit möglichst vielen Zeugen von außerhalb, sodass die Studierenden aus dem universitären Klima herauskommen. Oder ich schicke sie zu Recherchen beispielsweise in den Berliner Untergrund. Dort können sie sehen, wie diese Stadt unterschichtet ist und wie es Menschen geht, die ohne Pässe leben. Das ist eine Kombination aus ungewöhnlichen – also für konventionelle Hochschuldidaktik ungewöhnlichen – Veranstaltungsformen plus Aufenthalten in anderen Ländern. Das führt gelegentlich zur Entwicklung von Vorurteilsstrukturen bei der Universitätsverwaltung und einem Teil des Kollegiums, sodass es durchaus einige Reibereien innerhalb der Hochschule geben kann.
David Becker:
Nun könnte man ja sagen, dass du und deine Professorengeneration es irgendwie verratzt haben.
Jürgen Zimmer:
Inwiefern?
David Becker:
Weil ihr zur großen Mehrheit in den 70er-Jahren Professoren geworden seid, also die große Mehrheit solche progressiven Veränderungsinhalte in ihren Köpfen hatte, als sie Professor wurden, und weil heutzutage die gesamte verkrustete Universitätsverwaltung von Leuten gemanagt wird, die zu dieser gleichen Generation gehören. Trotzdem stehst du mit dieser Art von Lehre im Widerspruch zu dem, was offiziell an der Universität läuft. Da muss man sich doch fragen, was ist eigentlich passiert, dass es möglich war, statt dass hier lebendige Lehre stattfindet, heute dieser Spruch vom »Muff unter den Talaren« genau so wahr ist, wie er das vor 40 Jahren war, nur werden heute keine Talare mehr getragen. Den offenen Hemdknopf hat man gelernt! Was habt ihr denn eigentlich gemacht, dass das alles so geworden ist?
Jürgen Zimmer:
Ich glaube, dass es das »Wir« nie gegeben hat, sondern es gab – wenn ich die Freie Universität betrachte – auch damals nur eine Minderheit, die in einer ähnlichen Weise versucht hat, Reformen in Bewegung zu bringen. Schon in den Zeiten der Studentenbewegung gab's hier eine kritische Universität aus der Erkenntnis heraus, dass die Freie Universität insgesamt sich nur sehr bedingt bewegt, obwohl sie sich damals relativ viel bewegt hat mit einer Demokratisierung der Selbstverwaltung und projektorientierten Formen der Lehre. Aber es gab nur wenige Universitäten in der Bundesrepublik, von denen ich damals dachte, sie könnten sich auf den Weg machen. Das waren Bremen, Oldenburg und Kassel, die universitäre Forschungen und Entwicklungen auch auf die Region bezogen. Ich war damals in einer Planungsgruppe für Lehrerbildung in Bremen, und wir haben das auf die Entwicklung von Projektstudien konzentriert.
David Becker:
Wenn man sich deine Didaktik betrachtet, könnte man ein bisschen überspitzt sagen, du bist dafür, Menschen Situationen auszusetzen, bist bereit, ihnen ein Minimum an Vorbereitung dafür zu offerieren, aber der Schwerpunkt liegt darin, ihnen interessante Möglichkeiten zu bieten. Das ist nun mit Sicherheit die Art und Weise, wie du gelernt hast, weil du es geschafft hast, ziemlich furchtbare Situationen in deinem Leben als interessante Möglichkeiten zu sehen und umzugestalten, zum Beispiel in Hohenfels die Gänge unter dem Schloss zu entdecken. Es gibt Leute, die können das, aber es gibt auch Leute, die dabei verschütt gehen, die verloren gehen, die damit nicht umgehen können, oder schlimmer noch, die eine richtige Abwehr dagegen entwickeln, weil ihnen das zu unsicher wird. Nun kann man sagen, solche Studenten interessieren dich nicht. Trotzdem, diese Art von Pädagogik, wie du sie betreibst, was macht die mit Leuten, die eigentlich zu viel Angst davor haben?
Jürgen Zimmer:
Die suchen sich andere Studienschwerpunkte, bei denen das Gefahrenmoment relativ niedrig ist. Sie hätten vermutlich nicht so viel Angst, wenn sie besser begleitet würden. Da, finde ich, liegt ein kardinaler Mangel in der gegenwärtigen Praxis der Universität, dass wir keine »Heimathäfen« für studentische Gruppen gebildet haben. Meine Vorstellung ist, dass jeder Hochschullehrer eine Gruppe Studierender über ihr gesamtes Studium begleitet und im Auge behält — so ähnlich wie ein Vertrauensdozent der Studienstiftung. Der könnte auf biografische Komplikationen reagieren und den Studenten beistehen, wo sie Hilfe brauchen. Das Problem ist nicht, dass es Studenten mit Komplikationen gibt, sondern dass unsere Massenuniversität gegen solche Studenten verfasst ist.
Der Situationsansatz III
David Becker:
Der Situationsansatz scheint mir eine Pädagogik für die »Tom Sawyers« und »Roten Zoras« dieser Welt zu sein, also für komplizierte Kinder mit komplizierten Hintergründen, die aber kapiert haben, dass sie was tun können, sollen und dürfen trotz ihrer Verhältnisse, und die sich da einmischen und die unter gewissen Umständen auf schiefe Bahnen geraten können, aber die eben auch die Welt entwickeln können, wenn man Glück hat. Wie es bei Tom Sawyer immer heißt, »entweder du wirst Bürgermeister oder du kommst an den Galgen«. So weit so gut. Aber das sind und bleiben Ausnahmen. Ich hab nichts gegen Ausnahmen, ich hab auch nichts gegen eine Pädagogik, die diese Ausnahmen fördert. Nur frage ich noch mal: In dieser Pädagogik, was geschieht mit den Angepassten, was geschieht mit den grauen Mäusen, was geschieht mit denen, die diese essenzielle Kraft — die Tom Sawyer und die Rote Zora bereits haben und die auch Jürgen Zimmer offensichtlich irgendwann mal auf dem Weg nach Wasserburg entwickelt hat — nicht haben?
Jürgen Zimmer:
Da müsste man einen Blick auf die Anthropologie des Situationsansatzes werfen. Meine Überzeugung ist, dass alle Rote Zoras sind. Alle Kinder, die geboren werden, haben das Tom-Sawyer-hafte in sich, sind abenteuerlustig wie Huckleberry Finn. Das, was dann geschieht, ist die repressive Domestizierung von Kindern, die Aberkennung ungebremsten Neugierverhaltens, es können Traumatisierungen sein, die sie erleben und die sie ins Schneckenhäuschen zurücktreiben, oder die inszenierte Langeweile, die ihnen die Motivation abhanden kommen lässt. Da muss es dann um die Rekonstruktion von einer Art vergnügter Wildheit gehen. Insofern liegt mir durchaus daran, dass ich mit zahmen Personen gewisse wilde Ereignisse konstruiere, um Bewegungsräume zu schaffen. Das gelingt natürlich längst nicht überall.
Im Zusammenhang mit der westdeutschen Kindergartenreform wurde mir mit-geteilt, dass Kinderpflegerinnen, die weniger qualifiziert sind als Erzieherinnen, ungeeignet wären für solche Entwicklungen. Und wie war's? Als sie Entwicklungsprozessen in der Realität ausgesetzt wurden und miterfinden konnten, machten sie zum Teil hervorragende Erfindungen.
David Becker:
Ich denke manchmal, dass es für den Situationsansatz wichtig wäre, das Element Schutz besser zu definieren, da, wo es nötig ist. Du sagst ja auch, wenn ich dich nach den bedürftigen Studenten frage, die bräuchten jemanden, der ihnen über das ganze Studium nahe steht. Es stellt sich also die Frage, wie weit Schutz auf-gegriffen werden kann, konzeptionell, und wie weit man neben der Abenteuerperspektive deren dialektische Umkehrung zulassen könnte, die Depression oder die Trauer, da, wo sie nötig sind als Erfahrungshorizont. Beim Entrepreneurship meinst du, dass zum guten Entrepreneur auch dessen Scheitern gehört. Das kann man natürlich toll sagen, wenn man inzwischen den Erfolg hat, aber wenn man dreimal gescheitert ist, ist es nicht so vergnüglich. Es muss also irgendwelche Mechanismen geben, die erlauben, auch von diesen Verkehrungen und Verwerfungen zu sprechen. Aber konzeptionell ist das sozusagen nicht dein größtes Vergnügen, obwohl du da-von weißt. Das ist meine Vermutung.
Jürgen Zimmer:
Ich habe eine ganze Reihe von Fällen erlebt, bei denen ich sehr de-tailliert versuchte, mich auf eine Anamnese einzulassen, auf die Aufklärung von Depressionen von Menschen, mit denen ich umgehen wollte. Aber wenn du so eine Abenteuerpädagogik im Sinn hast — natürlich fällt es einem auf, wenn's wirklich virulent wird —, hast du natürlich die Tendenz zu glauben, auch die Stillen würden mitgerissen.
Ich sehe aber noch etwas anderes: Ich denke, es ist nicht nur die Depression, die das Gegenstück ist zu Abenteuer und Aktion bildet, sondern es ist auch die Gelas-senheit. Ich betrachte heute — stärker als früher — Personen, die in Gelassenheit leben wollen, mit hohem Respekt.
David Becker:
Du kämpfst für die Auflösung von einengenden Strukturen und glaubst an die Entfaltung von Lebendigkeit durch den Kontakt mit der Wirklichkeit, und zwar nicht als traumatisierendes Ereignis, sondern als zu gestaltende Erfahrung. Genau dafür aber braucht es Strukturen, wie man auch in deinem Leben immer wieder sehen kann, Strukturen die du manchmal benutzt, um dich gegen sie abzugrenzen, manchmal, um dich unmittelbar mit ihnen zu schützen, seien es nun rigide Wasserburger Strukturen, seien es Internate, sei es die Existenz, die eine offizielle Professur erlaubt. Man könnte also sagen, es gibt einerseits das Festhalten an und das Benutzen von offiziellen Institutionen und offiziösen Strukturen. Es gibt aber gleichzeitig auch die Überzeugung: »Es ist alles Unsinn mit diesen Strukturen, lass uns was ganz anderes machen.« Ist das eine angemessene Beschreibung von dir?
Jürgen Zimmer:
Sicher, weil du, um solche Ausflüge in die Wirklichkeit machen zu können, eine Basis brauchst, zu der du zurückkehren kannst. Und das ist natürlich ein verpflichtendes Privileg einer Stelle, die ein Kollege mal so definiert hat: »Ein Professor ist jemand, der sich jeden Monat sein Geld abholt und im Wesentlichen das macht, was er gerne machen möchte.« Da gibt die Freiheit der Forschung und Lehre eine Menge her, und insofern ist es sicher ein Privileg, das ich nicht hätte, wenn ich in einer Favela leben würde und mich dort mit den täglichen unmittelbaren Problemen zu befassen hätte.
David Becker:
Ich will dieses Privileg auch nicht abwerten. Im Gegenteil: Mir scheint, dass es ein wichtiges Element eines jeden guten Abenteuers ist, die Möglichkeit zu haben, an einen sicheren Platz zurückkehren zu können. Im pädagogischen Sinne würde ich annehmen, dass das die Sorgfaltspflicht ist, die man gegenüber denen hat, die man ausbildet, dass man ihnen einen Ort bietet, der ihnen nicht totale Sicherheit geben kann, sonst wäre es kein Abenteuer, aber der sie auch nicht alleine lässt. Und ich würde meinen, dass zum Situationsansatz die Struktur ebenso wie der Kampf dagegen gehört. Also ein bisschen Robinsohn ist immer dabei, obwohl letztendlich die Sympathien dann doch eher bei Freire und den lebendigen Prozessen liegen.
Jürgen Zimmer:
In diesem Sinne kann man auch die Internationale Akademie verstehen. Die Fesseln, die du angelegt bekommst, die zu einer Verlangsamung von Tätigkeiten und einer Verringerung der Wirksamkeit führen, die kann man ja entweder durch Flucht abstreifen — es gibt Hochschullehrer, die ihre Institute außerhalb grün-den — oder eben durch den Versuch, den wir gestartet haben, eine dynamische Institution an oder nahe der Universität zu gründen. Meine utopische Hoffnung dabei war, dass wir diese Universität von Grund auf lebendiger gestalten, neue Zellen entwickeln und eine Professorengeneration bilden, die in nicht unentscheidendem Maße auch außerhalb der Universität Dinge bewirkt, die Mittel erwirtschaftet – nicht nur durch Antragstellen, sondern durch eigene sozialunternehmerische Initiativen –, und dass wir damit auch den Studentinnen und Studenten ein anderes Modell der Lebendigkeit und des Ernstfalls bieten. Wir hätten uns eben viele gemeinnützige GmbHs an der Universität gewünscht und nicht nur eine. Das ist eine Geschichte, die nicht verwirklicht werden wird in einer Universität, die sich innerhalb von wenigen Jahren weitgehend konzeptionslos halbiert hat. Während damals in Bremen versucht wurde, das Projektstudium zu favorisieren, haben wir nunmehr ein stärker unternehmerisches Modell vor Augen. Beides fand und finde ich zu ihrer Zeit von Bedeutung.
David Becker:
Die Internationale Akademie ist also noch mal der Versuch, ein Stück Utopie zu verwirklichen und gleichzeitig Erlerntes und Erfahrenes abzusichern? Ein Stück weit Bruch mit der Universität und ein Stück weit die Universität fortsetzen, allerdings neu und besser?
Jürgen Zimmer:
Ja bestimmt. Allerdings wird für mich im jetzigen Lebensabschnitt die Gewinnung von Zeit und das Herausgehen aus dem Räderwerk, aus dem »Weiße-Mäuse-Strampel-Verhalten« wichtig und mit dem Gewinnen von Zeit die Zunahme der Intensität des Lebens.
Das Altern
David Becker:
Beim Älterwerden überlegt man, was man für Projekte hat, was man gerne mehr machen würde. Und man hat die Sorge, dass man halbwegs würdig leben möchte, wenn man älter, klappriger und irgendwie schwächer geworden ist, und sicherlich möchte man niemandem zur Last fallen. Aber es ist ja auch ein bisschen die Frage, wie man sich denn überhaupt mit dem Älterwerden fühlt. Wie fühlst du dich mit der Perspektive, dass sich die Zeit vielleicht verlangsamt oder anders wird oder dass man zwischendurch müder ist oder auf manches gar nicht mehr so viel Lust hat oder vielleicht anders Lust hat. Wie sind deine Gefühle zu diesem Thema?
Jürgen Zimmer:
Es gibt beides: große Lust am Leben und allmählicher Abschied. Einerseits gewinne ich durch das Wegfallen einer ganzen Reihe von Routinetätigkeiten und Pflichten die Chance, mich auf das, was ich dann wähle, besser und genauer einlassen zu können und dabei auch mehr Lebensqualität zu haben. Das ist das Positive. Ich tue weniger, bestimme mehr darüber, was ich tun will, und mache das dann wahrscheinlich auch besser. Das heißt, ich will überhaupt nicht aufhören mit Aktivitäten, sondern ich will mich nur konzentrieren und mein Manager sein und mich nicht managen lassen. Wenn du merkst, dass das Leben zeitlich ist, empfindest du es umso kostbarer, weil du dann mehr und mehr davon ausgehst, das war oder das ist es. Und nicht nur dein Leben, sondern du versuchst auch das Leben anderer als kostbar zu begreifen. Auf der anderen Seite erlebst du bestimmte Abschiede. Tod deutet sich an durch eine lange Kette von vorweggenommenen Abschieden. Man gibt einen kleinen Palast mit viel Wohnqualität auf — wie ich das gerade in Berlin gemacht habe — ünd zieht sich zurück. Allein das Erlebnis, dass ich aus einem großen Haus in so einen kleinen Anbau umgezogen bin, ist schon mal ein Abschied, Ab-schied von 20 Jahren Leben als »Nummer eins« in Steinstücken. Und so gibt es viele Momente ..., du gibst eine Menge von deinen Möbeln weg oder wirfst Papiere fort, von denen du der Meinung warst, dass sie alle sehr wichtig seien, und du begreifst, dass du viele Spuren nicht sichern kannst und auch gar nicht mehr willst. Du nimmst dich nicht mehr so wichtig und lernst insofern loszulassen.
Das alles ist mir in letzter Zeit deutlicher geworden.
David Becker:
In einem Artikel über dich meint die Lindauer Zeitung, von dir als »Berufsjugendlichem« sprechen zu müssen. Das ist ja ein Klischee für Erzieher. Aber irgendwas beschreibt es wohl auch von dir. Was denkst du zu diesem Klischee?
Jürgen Zimmer:
Wenn die damit meinen, dass ich mich jünger fühle oder wirke, als ich von der Anzahl der Jahre bin, dann find ich das gar nicht schlecht, und ich fühl mich auch selber so. Auf der anderen Seite gibt es ab einem bestimmten Erkenntnis-stand deines Lebens immer etwas Doppeltes. Du fährst fort wie in jungen Jahren zu leben, auf der anderen Seite fängst du an, Abschied zu nehmen.
David Becker:
Wenn »Berufsjugendlicher« heißen würde weiterhin wie Jugendliche zu versuchen, schmerzhaften Situationen mit einem gewissen »Spirit of Adventure« zu begegnen, könnte das etwas Erfreuliches sein. Wenn »Berufsjugendlicher« hieße, dass du nicht die Erlaubnis hast, älter und weiser zu werden, wäre das schade. Das hieße nämlich, dir die Erlaubnis zur Ruhe zu verweigern. Wir haben ja schon einige Male über dieses Thema gesprochen: Ruhe und Bewegung. Ruhe heißt für mich nicht Tod, sondern Ruhe kann ja auch einfach heißen, dass du dich ausruhst.
Nachgedanken über die Wanderschaft
Lieber Jürgen!
Wanderschaften sind der Ariadnefaden unseres Gesprächs gewesen.
Zu deinem 65. Geburtstag wünsche ich dir, dass du deiner Wanderlust noch lange weiter frönen kannst, allerdings mit dem Wissen und der Ruhe, dass du keine Heimat mehr suchen musst, sondern deren jetzt mindestens drei hast, dass du also dein Fernrohr auf das Abenteuer des Ankommens und Bleibens richten kannst. Lass dich einladen und schau mit mir hindurch: Da sind die Begegnungen mit Birzana und der Vater und Großvater und der nach wie vor aktive und unbequeme Professor. Da kannst du die kleine Farm in Thailand sehen und das endlich fertig gewordene neue Haus am Bodensee und eine schöne neue Wohnstätte in Berlin. Da siehst du den Jürgen, der manchmal glücklich und manchmal traurig ist, der aktiv ist und ausruhen darf, der endlich angekommen ist.