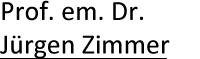"Begegnungen"
Ein Interview für die Zeitschrift "klein und groß“
Als Flüchtlingskind erlebte er Jagdszenen im Allgäu und am Bodensee, dort, in Wasserburg ging er in die Volksschule. Später wuchs er in Internaten - der Hermann Lietz-Schule und Salem – auf. Mit einem Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes studierte er Psychologie und Pädagogik in Hamburg, Freiburg und München. Zu seinen beruflichen Stationen gehörten das Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, das Deutsche Jugendinstitut in München, Universitäten in Tübingen, Münster, Berlin und São Paulo. Er hat in Ländern Lateinamerikas, Afrikas und Asiens gearbeitet, darunter in Argentinien, Brasilien, Uruguay, Chile, Costa Rica, Nicaragua, Mexiko, Trinidad, Ghana, Nigeria, Kenia, China, Hong Kong, Japan, Indonesien, Singapur, Malaysia, Thailand und den Philippinen.
In den siebziger Jahren prägte er die Kindergartenreform West, in den neunziger Jahren begleitete er die Kindergartenreform Ost. Er gründete das Institut für Interkulturelle Erziehung und setzte sich für die Entwicklung von interkulturellen, nachbarschaftsfreundlichen Schulen – von Community Schools – ein. Er gehörte zu den Gründern von "betrifft:erziehung", leitete das Bildungsressort der "Zeit" und ist einer der Herausgeber der "Neuen Sammlung". Seine Studenten nahm er oft mit an die Peripherien dieser Welt und setzte sie Ernstfällen aus. Er arbeitete für UNESCO, UN, OECD, GTZ und den Deutschen Bildungsrat und war zwei Jahrzehnte lang Vizepräsident und Präsident der International Community Education Association (ICEA).
Und heute? In Thailand entwickelt er ein Modell des kulturell sensitiven Tourismus, und verbindet es mit einem zweiten Modell, der "School for Life", einer unternehmerischen, entschulten Schule für Aids-Waisen und Kinder der Armen. Im April 2004 will er sich emeritieren lassen.
Wo sind Sie zu Hause?
Wenn ich zaubern und mich vervielfachen könnte, würde ich gern zugleich in Berlin, am Bodensee, auf Bali und auf einer kleinen Farm mit der "School for Life" im Norden Thailands leben. Und vielleicht auch noch in Salvador Bahia, einer Stadt mit hoher Intensität afro-brasilianischer Kultur.
Als Sie Ende der siebziger Jahre anfingen, auch in Entwicklungsländern zu arbeiten, flüchteten Sie da vor der Restauration, dem mühseligen Ende der westdeutschen Kindergartenreform?
Nein, überhaupt nicht. Wir hatten in dieser Reform, was den Situationsansatz und seine Verbreitung in neun Bundesländern anbelangte, viel von Paulo Freire gelernt, dem überragenden brasilianischen Pädagogen und Autor der "Pädagogik der Unterdrückten". Wir sprachen von Schlüsselsituationen, er von generativen Themen. Er wie wir wollten die Welt nicht einfach hinnehmen, wie sie ist, sondern die Verhältnisse menschlicher gestalten. Irgendwie drang die Kunde über unsere Arbeit nach Lateinamerika. Die ersten, die mich 1979 einluden, waren die in Managua gerade siegreich eingezogenen nicaraguanischen Sandinisten. Sie nahmen mich als eine Art Minensucher, der ihnen beim Aufspüren von bildungspolitischen Problemen half. Die hatte der aus dem Land gejagte Diktator Somoza hinterlassen. Mehr als Rudimente eines Bildungswesens waren nicht da. Ich arbeitete als unabhängiger Gutachter der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) und des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) mit den nicaraguanischen Partnern zusammen an der Regionalisierung des Bildungswesens, vor allem der Curriculumentwicklung: Die generativen Themen der Miskito-Indianer an der Atlantikküste unterschieden sich erheblich von denen der Campesinos auf der pazifischen Seite des Landes. Diese Themen änderten sich auch mit der Zeit. Je mehr die Contra zuschlug und das nordamerikanische Embargo griff, desto mehr wurden sie durch den Mangel geprägt. Sie begannen meistens mit "falta de…", also "Mangel an…" – an Energie, an Medikamenten, an Ersatzteilen, an Nahrungsmitteln… Konnte man sich vorstellen, Schulfächer so zu benennen: "Mangel an Medikamenten, und was man dagegen tun kann?" Man konnte.
Was kann man denn in Klassenzimmern gegen den Mangel an Medikamenten oder an Ersatzteilen tun?
Nichts. Deshalb: raus aus ihnen. Nicaraguanische Schüler haben damals eine Fülle pfiffiger Erfindungen gemacht: Sie haben dafür gesorgt, dass die Kontrastflüssigkeit im Röntgenapparat des Allgemeinkrankenhauses von Managua nicht nach dreißigmaligem Gebrauch für teures Geld in Schweden nachbestellt werden musste, sondern wiederaufbereitet werden konnte. Sie haben die Hitze, die ratternden Klimaanlagen nach außen abgeben, in die Kühle des nächsten Eisschranks transformiert. Sie haben daran getüftelt, Solarkocher zu bauen und gelernt, sich die Apotheke selber anzupflanzen. Sie trugen dazu bei, dass das Dengue-Fieber, eine Art Malaria, zurückgedrängt wurde, indem sie Relaisstationen der Überträger – kleine Wasserlöcher zum Beispiel, in die Mücken ihre Eier ablegen – trockenlegten. 95.000 Sekundarschüler und Studenten haben innerhalb eines halben Jahres 500.000 Nicaraguaner alphabetisiert, die zuvor des Lesens und Schreibens nicht mächtig waren. Die PISA-Konstrukteure waren bescheidener. Sie waren schon froh über die Fähigkeiten von Schülern zur Lösung realitätsnaher Fragestellungen. In Nicaragua aber ging es um wirkliche Probleme.
Also lieber erst eine Befreiungsbewegung und dann eine wirkliche Bildungsreform?
Nein, ob nun nach 1945 bei uns oder nach 1979 in Nicaragua: Bildungsreformen sind keine Selbstläufer. Darauf hat schon Shaul B. Robinsohn Ende der sechziger Jahre mit seinem viel zitierten Artikel über die "two decades of non-reform in West German education" hingewiesen. Und die Praxis der Einheitsschule in der DDR samt dazugehöriger dynamischer Begabungstheorie wurde mit der Einführung von Spezialschulen auch durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Die meisten Menschen rings um den Globus sind von der Vorstellung beherrscht, eine Schule könne nur eine Schule sein, mit Klassenzimmern, Kindern in Reih und Glied und frontalem Dompteursverhalten der Lehrer. Sie glauben an ein Museum, das im 18. und 19. Jahrhundert begründet wurde.
Auch ein Teil der nicaraguanischen Revolutionäre glaubte daran. Sie hielten es für wissenschaftlich und gerecht, wenn überall im Lande karge Klassenzimmer mit Schreibpulten, enggestricktem fächerfixiertem Curriculum existierten und die Schulaufsicht wusste, was in allen vierten Klassen des Landes am 19. Oktober in der dritten Stunde drankam. Die anderen nicaraguanischen Bildungsplaner, die Entschuler, die Lernen als theoriegeleitete aktive Teilhabe an der Entwicklung des Gemeinwesens fassen wollten, hielten die Verschuler für "quadraticos", für engstirnig.
Gab es Sieger oder nur Besiegte im Streit ums richtige Lernen?
1986 kam es zu einem handfesten Krach im Ministerio de Educación; zwei Fraktionen – übrigens meist junge Menschen so um die Mitte zwanzig – drohten sich wechselseitig zu lähmen. Sie luden mich ein, den Streit zu moderieren, und so zogen wir mit sechzig Personen für zwei Wochen auf einen Berg in die verlassene Villa einer ehemaligen Geliebten von Somoza und diskutierten über die Frage, ob man ein Curriculum nach Schulfächern strukturieren müsse oder an generativen Themen der Orte, der Regionen und des Landes orientieren könne. Das war übrigens die Veranstaltung, vor der ich am meisten Bammel hatte in meinem beruflichen Leben. Gesiegt haben dann alle, und am Schluss gab es eine große Party.
Wie das?
Die Idee hatte sich durchgesetzt, dass man interdisziplinäres wissenschaftliches Wissen 'plündern' und – ohne Umweg über Schulfächer und didaktische Filter – direkt auf Schlüsselsituationen und –probleme beziehen kann. Und dass man zusätzlich das Erfahrungswissen von Menschen braucht, die mit solchen Problemen schon einmal umgegangen sind. Und – Paulo Freire lässt grüßen – dass Lehrer zu Schülern und Schüler zu Lehrern werden und Reflexion und Aktion zusammengehören.
Die Sandinisten, zermürbt durch das Wirtschaftsembargo, die Contra und die hausgemachten Probleme, wurden Anfang der neunziger Jahre abgewählt…
…das ist richtig. Immerhin waren die Sandinisten die einzige Befreiungsbewegung, die ich kenne, die sich ein Dutzend Jahre nach ihrem Sieg einer wirklichen Wahl gestellt hat.
Und Sie?
Ich arbeitete mit Paulo Freire und seinem Team. Und mit Erzieherinnen in den neuen Bundesländern. Und mit ziemlich armen Pädagogen in Afrika und Asien.
Wir fahren jetzt mit dem Finger auf dem Globus herum und zeigen mal hier und mal dahin. Auf Brasilien zum Beispiel.
In Brasilien wollte das Movimento Negro Unificado, die afro-brasilianische Bewegung, der Frage nachgehen, ob man einen 'schwarzen' Bildungsbegriff entwickeln könne: Hundert Jahre nach der Aufhebung der Sklaverei leben die Schwarzen in der Mehrzahl immer noch ganz unten. Als ich mit Vertretern des Movimento in Rio de Janeiro ein Seminar über afro-brasilianische generative Themen durchführte, nannten sie als höchste Priorität "die Wiederherstellung der Würde", die "Entkolonialisierung des Körpers" und die "Entkolonialisierung der Kultur". Ich war überrascht, denn ich hatte eher Themen der unmittelbaren Existenzsicherung erwartet.
Andere Partner waren Guarani-Indianer in einem Reservat in der Nähe von São Paulo. Die fühlten sich von bewaffneten Bodenspekulanten bedroht und wollten eine Schule des kulturellen Widerstandes gründen. Die Idee war, traditionelles indianisches Wissen zu rekonstruieren, es mit modernem Wissen zu verbinden und in diese Akademie nationale wie internationale Gäste als eine Art öffentlichkeitswirksame Schutzschilder einzuladen. Wir hatten kaum die Bautätigkeiten begonnen und Gelder einer freundlichen Schweizer Stiftung sowie publizistische Unterstützung bekommen, da geschah etwas Unerwartetes.
Die Bodenspekulanten?
Nein, die größte brasilianische Fernsehstation kam und drehte eine 42-teilige Soap Opera über die Liebe zwischen der sehr hübschen Tochter des Häuptlings und einem brasilianischen jungen Mann von außerhalb. Halb Brasilien guckte zu, und anstelle der Schule des Widerstandes brauchten die Guarani nur noch Eintritt zu nehmen und die Gäste zu bewirten, die die Drehorte besichtigen wollten.
Hermann Glaser, seinerzeit Kulturdezernent in Nürnberg und ich wollten einmal über hundert Brasilianer in verschiedenen deutsche Städte einladen (was auch geschah) – Volksmusiker, Volksmediziner, Künstler aller Art aus den städtischen Favelas und verarmten Regionen des Sertão. Zu Beginn unseres Vorhabens sagt er: "Wenn wir scheitern, dann möglichst auf hohem Niveau." Den Satz habe ich mir gemerkt. Die Guarani-Geschichte endete auf interessantem mittlerem Niveau. Immerhin: Die Bodenspekulanten riskierten nicht mehr, die Indianer aus ihrem Reservat zu vertreiben.
Ghana und Nigeria…
In Ghana ging es um die Entwicklung vorschulischer Erziehung unter Vermeidung der Versuchung, achtzig Kinder in eine kleine Hütte zu quetschen und "Kindergarten" darüber zu schreiben, während draußen das Leben tobt. Ungewöhnlich waren die pädagogischen Einfälle zu Schlüsselsituationen. "Verlaufen im Busch"? Die Antwort: Kinder lernen eine Skala unterschiedlich spitzer Schreie, von "hallo Mama und Papa, hier bin ich" bis – ganz spitz – "Schlange beißt gleich". Da sich an dieser Arbeit Frauen aus verschiedenen Provinzen beteiligten und ihre Erfahrungen austauschten, entdeckten wir ein spezielles Tabu: In der einen Region aßen die Frauen kein Hühnerfleisch. Die Frauen aus einer anderen Region, die durchaus Hühnerfleisch außen, fragten, wer denn den hühnerfleischlosen Frauen das eingeredet hätte. Ihre Männer, antworteten sie. Da lachten alle und stellten fest, dass die Männer die Frauen ausgetrickst hatten, um das Hühnerfleisch allein verspeisen zu können, und demnächst wohl eins auf die Mütze bekommen müssten.
In Nigeria hatte mich die Provinzregierung von Badagry gebeten, ein Problem in einigen Primarschulen anzugehen. Nicht nur Schüler schwänzten, sondern auch Lehrer. Es war nicht schwer herauszufinden, warum sie wegblieben. Sie, arm wie die Kirchenmäuse, schmuggelten Ware über die nahe Grenze nach Benim. Frage: Wie kann man eine Schule weiterentwickeln, dass in oder mit der Schule mehr Einkommen erwirtschaftet werden kann als durch Schmuggeln? Das Stichwort lautet "Entrepreneurship" – was meint: ein Habenichts zu sein, eine gute Idee zu entwickeln und zu verfeinern und sie mit Beharrlichkeit im Markt zu verwirklichen. Die Antwort auf die Frage ist gleichwohl nicht leicht.
Sie haben in anderen Ländern, darunter den Philippinen, weiter an dem Versuch gearbeitet, Bildungsprozesse so zu gestalten, dass die Kinder der Armen nicht nur etwas lernen, sondern auch etwas verdienen können. Eine Sisyphusarbeit?
Ja und nein. Ich habe viel mit meinem Kollegen Günter Faltin zusammenarbeitet, und wir haben gelernt, die Kinder der Armen als Unternehmer zu verstehen. In Manila wurde eine "Productive Community School" am Smokey Mountain gegründet, dem rauchenden, kadavergleichen, riesigen Müllberg der Stadt. Ein alter Mann hatte den Kindern am Berg sein Geheimnis verraten, wie man ausgebrannte Neonröhren wieder zum Leuchten bringen kann.
Eine andere Schule nahm sich vor, rückstandsarmen Reis an eine zunehmend aufgeklärte Kundschaft zu verkaufen. Eine dritte entstand in Gestalt des Restaurants "Hapag Kalinga" am Rande des Rotlichtbezirks Ermita. Der Gründung ging ein Workshop auf einem öffentlichen Platz mit Straßenkindern, Kinderprostituierten, Polizisten, Zuhältern, dem Priester von der nächsten Kirche und einem korrupten Bezirksbürgermeister namens Kojak voraus – finanziert übrigens vom Goethe-Institut und seinem damaligen couragierten Leiter Uwe Schmelter. Die Straßenkinder hatten die zündende Idee, ein Abenteuerrestaurant zu gründen – mit einer kanadischen Lagerfeuerecke, einer koreanischen Bulgogi-Brutzelecke oder einer italienischen Ecke samt Nudelmaschine für die Eigenproduktion. Heraus kam dann ein Restaurant mit wechselnder regionaler Küche – die Philippinen bestehen aus 7500 Inseln – und Kindern, die hochmotiviert an ihr Werk gingen.
Befreiungsbewegungen kommen und gehen, Bildungsreformen kommen und gehen. Und Projekte?
Ja, die auch, und das ist bei uns in Deutschland genauso wie anderswo. Vordem berühmte Schulen entwickeln sich ins Mausgraue zurück. Kindergärten mit besonderem Profil geht irgendwann der lange Atem aus. Altes verschwindet, Neues kommt. Und nur in wenigen Fällen gelingt es, mit Beharrlichkeit an der Spitze der Reform zu bleiben.
Beim Lernen in der Wirklichkeit kommt es eben oft anders als geplant. Nigel Barley, heute nach meiner Erinnerung Direktor eines bedeutenden Londoner kulturanthropologischen Museums, war immer sehr beeindruckt von den fulminanaten Berichten seiner ethnologischen Kollegen über ihre Feldforschungen, bis er sich selbst nach Schwarzafrika begab, um einen in Abgeschiedenheit lebenden Stamm zu untersuchen. Barley's Quintessenz: Der Stamm nutze ein Jahr lang intensiv die Möglichkeit, einen britischen Ethnologen zu beforschen, während Barley sich die ganze Zeit in den Vorbereitungen zu seinen Forschungsarbeiten verhedderte. Immerhin hat er eines der witzigsten Bücher – "Traumatische Tropen" – über die geheimen Wahrheiten ethnologischer Feldforschungen verfasst.
Vor ein paar Wochen traf ich im Norden Thailands Winfried Muziol, dessen Business Card ihn als "Consultant – Small Enterprise Development" ausweist, und der drei Jahrzehnte lang im Auftrag der GTZ in Afrika gearbeitet hat. Ich frage ihn nach seinem Fazit und wollte wissen, ob er sich am Ende wie Sisyphus gefühlt hat. Seine Antwort: Solange er da war und Geld floss, war – abgesehen von Malaria tropica, Bilharziose, Hirnhautentzündung und Fischvergiftung – alles wunderschön. Nur glaube er nicht, dass die von ihm in Niger mit lokalen Partnern gegründete Industrie- und Handwerkskammer seinen Abgang und den Abzug der Mittel um mehr als wenige Monate überlebt habe. Er habe die GTZ wiederholt angeregt, eigene Projekte nicht nur während ihrer Laufzeit, sondern fünf Jahre danach zu evaluieren, aber sie vermeide dies tunlichst, denn auch die GTZ würde nur ungern den Ast absägen, auf dem sie sitzt. Muziol und ich haben dann während der Happy Hour das Gerede von der "Sustainability", der Nachhaltigkeit als Mythenbildung der internationalen Konferenzmaschinerie verworfen und unsere eigene Theorie entwickelt. Es kommt auf das Well-being aller an einem Projekt Beteiligten im Hier und Jetzt an. Die Gegenwart zählt. Das Paradies auf Erden ist an den Augenblick gebunden.
China und Hong Kong…
Das war meine letzte Reise mit Hellmut Becker, dem Gründer und Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung und Sohn des früheren preußischen Kultusministers Carl Heinrich Becker. Der Vater Becker war zur Zeit der Weimarer Republik Leiter einer Delegation des Völkerbundes gewesen, die auf Wunsch Chinas das Land inspizierte, um Empfehlungen für die Modernisierung des Bildungswesens auszusprechen. Unsere Aufgabe war eine andere. Wir reisten zu einer Zeit, in der das Massaker in Peking noch nicht stattgefunden hatte, die Frage der Integration von Hong Kong jedoch schon am Horizont auftauchte. Eine chinesische Delegation von Bildungsplanern sollte sich eine Woche lang mit einer Delegation aus Hong Kong treffen, um Fragen der Integration des Bildungswesens von Hong Kong zu erörtern. Unsere Rolle sollte die der ehrlichen Makler sein. Wir fuhren deshalb zunächst nach China, um dort das Bildungswesen zu studieren, hielten uns danach mit dem gleichen Ziel in Hong Kong auf und moderierten das Treffen. Das Ergebnis war überraschend: Die Vertreter Chinas interessierten sich mehr dafür, wie sie ihr eigenes Bildungswesen in Richtung Hong Kong weiterentwickeln könnten und weniger für die Frage, wie das Bildungswesen von Hong Kong nach 1997 chinesischen Verhältnissen unterzuordnen sei.
Alle Kinder dieser Welt sind Kinder, oder?
Einerseits ja, und es ist erstaunlich, wie sie katastrophische Verhältnisse oder vermurkste Erziehungsbemühungen von Erwachsenen überstehen. Andererseits ähneln die Kinder der Armen mehr den Huckleberry Finns und Roten Zoras, sie sind wilder, kräftiger, verletzter und härter. In den vielen Workshops, in denen ich Erzieherinnen und Lehrer fragte, welche Situationen ihrer Kinder hier in ihrer Region, an ihrem Ort von besonderer Bedeutung seien, waren die Antworten sehr unterschiedlich. Sie variierten nach sozialgeographischen und gesellschaftlichen Umständen. Die Schlüsselsituationen eines dreijährigen, reichen Kindes in Hong Kong "Am Morgen schickt mich meine Mama in die Vorschule, am Nachmittag in ein Tutorium, und danach muss ich anderthalb Stunden Hausaufgaben machen" ist anders als die eines armen Kindes in Hong Kong: "Allein zu Hause" bedeutet für letzteres, in einer ärmlichen Etagenwohnung im siebzehnten Stockwerk acht oder zehn Stunden eingesperrt zu sein – während die Eltern bei der Arbeit sind – und zu lernen, wie man mit den Gefahren von Feuer und Strom, dem Hunger und der Einsamkeit umgeht.
Deutschland heute…
Im Zusammenhang mit dem Projekt "Kindersituationen" in den neuen Bundesländern war es mir vergönnt, eine Sternstunde der empirischen Forschung im Kindergartenbereich mitzuerleben, die dringend gewünschte externe empirische Evaluation des Situationsansatzes. Seine Kritiker hatten sich eine messerscharfe Untersuchungsanlage ausgedacht, um herauszufinden, ob die Arbeit nach dem Situationsansatz sichtbare Spuren bei den Kindern hinterlässt. Es wurden drei Gruppen gebildet: Einrichtungen, die nach dem Ansatz arbeiten, Einrichtungen, die in der Nähe des Ansatzes lokalisiert sind, und solche, die von sich sagen, dass sie nichts damit zu tun hätten. Das Ergebnis der Evaluation, die von einer unabhängigen Forschergruppe der Universität Landau durchgeführt wurde, war, dass die Kinder des Situationsansatzes – von heute aus gesehen – die idealen PISA-Kinder sind. Die Evaluation erbrachte, dass sie ihre Themen eigengesteuerter behandeln, länger und hingebungsvoller dranbleiben, problemlösungsorientierter arbeiten, ihre Konflikte häufiger untereinander regeln, die Erzieherinnen seltener einschalten und damit über mehr Autonomie verfügen. Als diese erfreulichen Ergebnisse bekannt wurden, gab es den Zweifel einiger der dem Situationsansatz immer schon kritisch gegenüberstehenden Empiriker am Evaluations-Design, das sie zuvor selbst mit entwickelt hatten: Es würde alles nicht stimmen. Darauf meinte die Landauer Forschergruppe pikiert: Man müsse schon akzeptieren, was die Evaluation erbracht habe, und könne Ergebnisse nicht nur dann annehmen, wenn sie einem in den Kram passen.
Die Untersuchung wurde vier Jahre später wiederholt. Wer dachte, nun käme wirklich nichts mehr heraus, weil Kinder und Erzieherinnen nach Abschluss der Modellversuche wieder allein waren, täuschte sich. Es wurde erneut Autonomie nachgewiesen. Diese Aussage ließ mich erleichtert auf Reisen zu anderen Orten meiner Arbeit gehen.
Vielleicht vermisst man Sie. Gerade jetzt.
Wer weiß? Der Frage, wie man die Entwicklungsergebnisse von beteiligten Modelleinrichtungen auf möglichst viele andere Kindergärten überträgt, stand ich nach den Erfahrungen der siebziger Jahre ohnehin skeptisch gegenüber, denn Politik ist kurzatmig, und ich fürchtete, dass die Kindergärten in den neuen Bundesländern, die gelernt hatten, nach dem Situationsansatz zu arbeiten, nicht in den Stand gesetzt wurden, als Konsultationseinrichtungen auf breiter Ebene zu wirken.
Nun gibt es allerdings eine qualitäts- und reformstützende Gegenbewegung, die stärker ist als nur das Fähnlein der sieben Aufrechten. Dazu gehören Träger, Ausbildungseinrichtungen, eine wachsende Zahl von Praxiseinrichtungen, die in qualifizierter Weise nach dem Situationsansatz arbeiten, ein großes Netz erfahrener Expertinnen sowie das Institut für den Situationsansatz, ISTA, das wesentlichen Anteil an der Verbreitung und Weiterentwicklung des Konzepts hat.
ISTA ist ein Teil der INA. INA, die Internationale Akademie für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie, haben Sie mit anderen zusammen als gemeinnützige GmbH an der Freien Universität gegründet. Warum? Weil die Universitätsbürokratie zu umständlich arbeitet? Und weshalb "an" der FU und nicht "jenseits" von ihr?
Ich wollte nicht fliehen, sondern herausfordern und nicht ständig die Langsamkeit aushalten.
Was planen Sie selbst für die Zeit nach der Emeritierung? Die einsame Insel unter Kokospalmen?
Gewiss nicht. Aber ich war immer ein Wanderer. Meine Mutter zog in ihrem Leben achtundzwanzig Mal um, ich oft genug mit. Für mich ist es kein Weggehen, wenn ich zeitweise andernorts arbeite, schon gar nicht, wenn ich diesen Planeten als eine Welt begreife. Ich finde, ich habe sogar die Verpflichtung an Orten zu arbeiten, an denen es weniger rosig zugeht als in der Bundesrepublik.
In den vergangenen fünfundzwanzig Jahren war ich in anderen Ländern immer zufrieden, wenn ich dort zu arbeiten hatte. Bei den wenigen Aufenthalten, die ich als Tourist absolvierte, ging es mir eher schlecht, weil ich in den Hotellobbys auf Reiseleiter wartete, die mich zu überlaufenen Sehenswürdigkeiten oder in Geschäfte führten, in denen ich über den Tisch gezogen wurde. Mit ungutem Gefühl fuhr ich jedes Mal zurück, weil ich die Menschen im Land nicht getroffen hatte.
Aber man kann ein Land auch anders erleben, nicht als Gefangener der Tourismusindustrie. Ich berate deshalb in Thailand ein Projekt, das inzwischen auch in den deutschen Medien bekannt geworden ist: Joy's House. In Chiang Mai öffnete eine thailändische Familie ihre Türen für Menschen, die sich jenseits ausgetretener Touristenpfade für die Kultur und den Alltag des Landes interessierten. Eine knappe Autostunde von Joy's House entfernt liegt Joy's Farm in den Bergen, im königlichen Forst. In der Nähe der Farm liegt das Dorf Pongkum. In dem Dorf fanden wir 28 Kinder, deren Eltern an Aids gestorben sind oder die in anderen schwierigen Situationen lebten. Gäste von Joy's House und ich überlegten, was man für diese Kinder tun könnte. Das Ergebnis: die Entwicklung der School for Life. Als meine Mutter 1998 im Alter von 86 Jahren an Leukämie starb und am Tag ihres Begräbnisses in Lindau ein von ihr vorbereitetes Solidaritätskonzert mit 100 Musizierenden und 1000 Besuchern für Kinder im Kosovo stattfand, kamen Spenden in Höhe von 20.000 DM zusammen. Der Versuch, das Geld an guter Stelle im Kosovo zu platzieren, scheiterte. Nun kommt das Geld den Kindern der School for Life zugute, als einem Modellprojekt für weitere Einrichtungen dieser Art. Wir wollen damit keinen Königsweg erfinden, dazu sind wir zu schwach. Aber wir können Beispiele schaffen und dort beginnen, wo uns die Not begegnet.
Fazit: Leute, wandert aus! Es gibt andernorts viel zu lernen, viel zu tun, und das Leben ist schöner als im tristen Deutschland.
Vielleicht sollte man besser sagen: Leute, wandert ein in die Welt jenseits unserer Grenzen. Man muss ja sein kleines Häuschen nicht gleich aufgeben, aber man sollte sich mal anderswo umsehen. Man lernt Toleranz, legt Ängste vor Fremden ab, wenn man ihnen von Angesicht zu Angesicht begegnet und eine Zeit lang mit ihnen zusammenlebt. Das wäre für uns Deutsche nicht schlecht, die wir Meister in Fremdenfeindlichkeit und im Ausgrenzen sind. Und es tut gut, über den Tellerrand zu schauen, zurück zu kommen und hier mit neuen Erfahrungen weiter zu arbeiten.
(Gesprächsaufzeichnung: Erika Berthold)
In: klein & groß, Heft 5, 2003