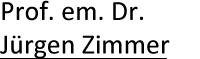Prof. em. Dr. Jürgen Zimmer
Das halb beherrschte Chaos
Sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Husung,
sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, liebe Christine Keitel-Kreidt,
liebe Frau Rau,
lieber Hartwig Henke,
liebe Familie, liebe Freunde, Kolleginnen und Kollegen,
die Nachricht von der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes wurde nach Berlin-Steinstücken geschickt – meinem Heimatdorf zu Zeiten der Mauer, die meine Gartenmauer war. Dort bin ich aber vor ein paar Jahren ausgezogen, und so machte sich die Nachricht auf die Suche nach mir, bis sie mich – ich kam gerade von den Schools for Life in Thailand zurück – in der Internationalen Akademie in Berlin-Dahlem einholte.
Meine Reaktion: Überraschung, große Freude, mittleres Erschrecken. Mir fielen weniger die guten Taten als vielmehr die Unebenheiten meines Lebens ein, die Zufälligkeiten, die Situationen des Scheiterns, der Unbill, die ich erfahren oder anderen zugefügt habe.
Die guten Worte, die Sie hier für mich gefunden haben, ehren mich, und ich danke Ihnen sehr dafür. Dies ist ein Moment des Glücks.
Mein Thema gilt aber nicht diesem Augenblick und der Verantwortung, die ich mit dieser Verleihung übernehme, sondern dem halb beherrschten Chaos in meinem Leben. Was damit gemeint ist, hat Herman Melville 1855 in seinem Buch "Israel Potter – Seine fünfzig Jahre im Exil" beschrieben:
"Die Laufbahn eines hartnäckigen Abenteurers erweist sinnfällig den Grundsatz: Wer im Großen Erfolg haben will, darf nicht auf glatte See warten, die es nicht gegeben hat und nicht geben wird, sondern er muss mit der zufälligen Methode, über die er nun einmal verfügt, und mit aller Verblendung auf sein Ziel zustürzen und das Übrige dem Glück überlassen, denn alle menschlichen Verhältnisse sind von Natur aus unübersichtlich, da sie einer Art halb beherrschtem Chaos entspringen und von ihm unterhalten werden."
Und nun: sechs kurze Kapitel über Unübersichtlichkeiten in meinem Leben:
Erstens: das nicht beherrschte Chaos
Es waren die Bombennächte in Kassel, das Warten im Luftschutzkeller, die Volltreffer in der Nachbarschaft, meine Großmutter, die während der Angriffe auf den Dachboden ging, um nach den Eimern mit Sand und herabgefallenen Brandbomben zu suchen, der glitzernde Regen abgeworfener Stanniolstreifen, die die deutsche Flak irritieren sollten, Papier, das aus den Fenstern der brennenden Parteizentrale in der Humboldtstraße gewirbelt wurde. Das nicht beherrschte Chaos prägte meine ersten Erinnerungen.
Als wir dann beim Bauern in St. Margarethen, oberhalb der Sonthofener Ordensburg unterkamen, weil mein zweiter Vater (mein leiblicher Vater war gefallen), der mit dem Kreisauer Kreis sympathisierte, in dieser Kaderschmiede Deutsch und Sport unterrichtete, schien es für kurze Zeit besser zu werden. Kein Kriegslärm war zu hören, stattdessen das Gebimmel der Kühe. Die gelegentlichen Besuche der NS-Schranzen von Ley bis Göring wirkten wie Theatereinlagen. Mir tat ein britischer Pilot leid, der einsam am Fallschirm vom Himmel schwebte, während ihn unten eine johlende HJ-Meute erwartete.
Dann, Anfang 1945, der Freitod meines Vaters. Ich sah, wie das Blut unter der Badezimmertür durchsickerte – er hatte sich die Pulsader aufgeschnitten – , wie meine Mutter und eine Ärztin die Tür aufbrachen und ihn herausführten, und ich sah nicht, weil ich zurückgehalten wurde, wie er über die Balustrade hechtete und auf einem Steinkreis im Innenhof der Ordensburg aufschlug.
Meine Mutter war verzweifelt und wütend, als ich während der Trauerfeier auf der Ordensburg aufstehen und "Heil Hitler" sagen sollte. Mit dem Sarg im Gepäck zogen wir um nach Wasserburg am Bodensee, und als mein Vater auf dem Nordfriedhof begraben wurde, wollte der Ortsgruppenleiter samt Jungmannen Spalier stehen, aber meine Mutter scheuchte sie weg.
Das nicht beherrschte Chaos nach Kriegsende in Wasserburg: marodisierende französische Kolonialtruppen, Jagdszenen in einem stockkatholischen Dorf mit mir als andersgläubigem gehetztem Hasen. Jeder Schulweg, jede Pause eine Qual. Sie hänselten mich, warfen meinen Ranzen in den See, henkten meine Katze, ließen mich einen umgedrehten Eimer hochheben, unter dem ein Schwarm Wespen hervorschoss. Es war die Zeit, in der ich ein Gefühl für die Diskriminierung von Minderheiten entwickelte, eine Erfahrung, die mich später auch beruflich leitete.
1948 kam ich auf den Hohenfels, eine Raubritterburg im Hegau, nunmehr die Unterstufe von Salem. Ich beherrschte mein Leben dort nicht. Wir Sextaner heulten abends vor Heimweh, ich auch, obwohl mir mein Heimatdorf übel mitgespielt hatte. Wir waren ein Dutzend, als wir wegliefen. Mit dabei war Ellen, mein erster Schwarm, von der ich nicht wusste, dass ihr Vater – Hanns Ludin – als Gesandter in Slowenien für die Deportation von Juden verantwortlich war und nach Kriegsende hingerichtet wurde. Kinder von Tätern und Kinder von Mitgliedern des Widerstandes trafen in Salem aufeinander.
Wir lebten auf unserer Flucht von reifen Äpfeln an hochstämmigen Bäumen und vom Ausfüllen der Totoscheine bei Bauern, die uns dafür Essen anboten. Das verheißene Paradies, der Ludin'sche Gutshof, auf dem wir schließlich landeten, erwies sich als Falle. Wir wurden dort erwartet, zusammengestaucht, mussten den Weg unter Bewachung zurückmarschieren, zogen noch singend – und, wie wir dachten: als Freiheitshelden – durchs Burgtor, spürten dann aber die Strafe: Vier Wochen lang dürfte keiner mit uns reden. Mein Gefühl der Diskriminierung wurde ergänzt durch die Erfahrung des selbstinszenierten Outlaw, und der Freiheitsdurst wich einem wachsenden Gefühl der Beklemmung.
Zu meinen Internatsstationen gehörte die damalige Mittelstufe der Hermann Lietz-Schule, Schloss Bieberstein in der Rhön. Ich wurde zum Schulsprecher gewählt. Meine tägliche Niederlage bestand darin, dass ich im Speisesaal allein – ich weiß nicht mehr, warum und wohin sich die Erwachsenen verzogen hatten – eine große Meute halbwüchsiger Jungen zu beaufsichtigen hatte, mit Porridge, Nudeln und Pudding um sich werfende Chaos-Anhänger, gegen die ich anfangs überhaupt nicht ankam. Erst als ich eine Art Kabinett mit 'Gebietsfürsten' bildete, die sich strategisch im Speisesaal verteilten, wurde aus dem nicht beherrschten ein halb beherrschtes Chaos.
Zweitens: das erfinderische Chaos
Es gab eine Zeit, da waren lehrersichere Unterrichtseinheiten im Schwange. Ganz anders im Situationsansatz. Die westdeutschen Erzieherinnen, als über ihrer Kindergruppe hockende und sie unterfordernde Glucken diskriminiert, waren eingeladen, ihre Kenntnis der Lebenswirklichkeit von Kindern pädagogisch zu nutzen. So geschah es in Rheinland-Pfalz und Hessen, später in allen westdeutschen Bundesländern mit Ausnahme unserer beiden kulturhoheitsbedachten Südstaaten. Wir begleitenden Wissenschaftler erlebten überraschende Entwicklungen: Der Situationsansatz lief zwar nicht aus dem Ruder, aber doch in produktiver Weise in unerwartete Richtungen. So gesehen, war er nicht beherrschbar und sollte es auch gar nicht sein.
Die Minderung der Angst von Kindern vor dem Krankenhaus? Ja, aber nicht nur durch freundliche Aufklärung im Gruppenraum, sondern durch den Einbezug des fremdartigen Ortes, durch Besuche von und Spiele mit kranken Kindern, durch die Zusammenarbeit von Erzieherinnen und Schwestern beim Thema "besseres Spielzeug für die Kinderstation" oder durch die Beteiligung an der Bürgerinitiative "Kinder im Krankenhaus" samt der Befragung von Kommunalpolitikern während des Wahlkampfes zu Themen wie "Rooming in" oder "tägliche Besuchszeiten" – damals, als dies alles nur im fernen Kalifornien üblich war.
Manchmal schossen motivierte Erzieherinnen übers Ziel hinaus oder scheiterten auf halber Strecke: Die Vorstellung, vereinsamte alte Menschen als neue Großmütter für die Kindergruppe zu adoptieren oder mit Hilfe des Kindergartens zwischen jungen Familien in Wohnblocks und alten Leuten neue Beziehungen zu stiften, konnte im einen Fall gelingen und im anderen nicht, wenn die Kindergruppe zum Beispiel bei einem schlecht vorbereiteten Besuch im Altersheim nicht auf freundliche Menschen traf, sondern in einen Pflegetrakt geriet und keinen Kontakt aufnehmen konnte. Gleichwohl: Großmütter im Kindergarten wurden beliebt, und mit ihnen das Flohhüpferspiel und Feste im alten Stil.
Eine bildungspolitische Pointe ließ sich im Fall des bundesweiten Erprobungsprogramms im Elementarbereich in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre beobachten, eines Programms, bei dem sich der Situationsansatz durchsetzte, während andere curriculare Konzepte und Materialien abgewählt wurden. Dem war ein Eiertanz der kooperierenden Bundesländer vorausgegangen: Die Materialien durften nicht länderübergreifend weiterentwickelt, sondern sollten nur erprobt werden. Die Rechnung der Sozial- und Bildungsministerien ging nicht auf. Die Erzieherinnen entwickelten erfindungsreich weiter.
Drittens: das produktive multikulturelle Chaos
Berlin-Kreuzberg, Mitte der achtziger Jahre. Im Windschatten der Berliner Zentralregierung stellt Kreuzberg, bildungspolitisch gesehen, das kleine gallische Dorf dar. Wir wollen interkulturelle Nachbarschaftsschulen entwickeln, mit offenem Unterricht und Einrichtungen, wie wir sie in britischen Community Schools bewunderten: Schule als Schule und Volkshochschule in einem, Schule als Kulturzentrum, als Vereinslokal, als Werkstatt, als Job-Börse, kurzum als ein Stadtteil- oder Gemeindezentrum, das ungefähr so viele Nachbarn wie Kinder anzieht.
In der Zille-Grundschule wird das 'Café Aula' zum interkulturellen Treffpunkt, auf dem Hof der Lenau-Grundschule überleben Schafe aus meiner Steinstückener Herde, im 'Café Ele Ele' können sich Eltern zum Schwatz treffen. Dies ist nun die friedenstiftende "Landnahme durch fremde Kulturen", vor der der Landesschulrat Bath, in Laurins Diensten, so eindringlich gewarnt hat. "Weiße" Eltern, zuvor aus Kreuzberg ausgewandert, bilden Fahrgemeinschaften, um ihre Kinder an die Lenau-Grundschule zurückzubringen. Zum Schuljahresbeginn hat die Schule, nunmehr zur Magnetschule geworden, 400 Bewerbungen für die erste Klasse, während es in der Schule nebenan nur fünf sind. In der Zille-Grundschule gibt es eine Kampfabstimmung bei der Wahl der neuen Schulleitung: Hannelore Kern steht für die Reform, ihr Konkurrent verspricht Ruhe an der Front. Als Hannelore Kern siegt, kann sie nachts kaum schlafen, weil Eltern von sonstwoher anrufen und ihre Kinder in der Zille-Grundschule anmelden wollen.
Herr Höhne, Leiter der Lenau-Grundschule und im Vorstand von Hertha Zehlendorf, erzählt mir von der Anfrage einer türkischen Familie, die eine Hochzeit in der neugebauten Schule feiern möchte. Höhnes Schrecksekunde: ‑ wer haftet, wer passt auf, wer macht sauber? ‑ dauerte zu lange, so dass sich die Familie einen anderen Ort suchte. Als ich Höhne dann beschwor, beim nächsten Mal ohne Schrecksekunde "ja" zu sagen, geschah das etwas später auch. Es erschien eine Delegation aserbaidschanischer Männer mit dem Wunsch, in der Aula ein Frühlingsfest feiern zu dürfen. Höhne sagte sofort "ja", und es kam eine sehr große Anzahl von Männern mit einer Bauchtänzerin. Das Fest war schön, die Kinder durften dabei sein, und das Thema Bauchtanz bestimmte das Erscheinungsbild der Schule noch eine geraume Weile.
Geschieht das alles wie von selbst? Nein, denn es kann zur Energiebindung in einem Kollegium kommen, wenn die einen wollen und die anderen nicht; oder die Zentralregierung kann Wind bekommen von interkulturellen Metamorphosen deutscher Schulen und finden, eine Schule habe deutsch und nichts als deutsch zu sein und möglichst noch mausgrau dazu. Mich erinnert das an Edgar Alan Poes Geschichte vom Mahlstrom: Man wird abwärts gezogen, strampelt, findet heraus, genießt die Weite des Horizonts, entwickelt Ideen und wir zurückgeholt vom Sog eines Museums Schule, die im Kern immer noch aus geschlossenen Räumen, frontalen Unterweisungen und Lebensabgewandtheit besteht. Günter Faltin hat einmal angemerkt, man solle Eintrittsgelder verlangen, um ein solches Museum besuchen zu dürfen. Und Siegfried Bernfeld hat diese Sichtweise in seinem Buch "Sysiphos oder die Grenzen der Erziehung" (1925) so ausgedrückt:
"Und das ist die Lächerlichkeit der didaktischen Situation. Da denkt, schreibt, experimentiert, agitiert sie redlich und fleißig – und sieht nicht, dass ihr Tun unnütz ist, weil es am falschen Ort geschieht. Zugleich aber – und das ist das Verwerfliche – erhält sie das Bestehende, indem sie, selbst abgelenkt und abseitig tätig, aller Aufmerksamkeit vom Feinde ablenkt. Aller Arbeitskraft nutzlos vergeudet. Nein, nicht erfolglos. Dient es doch dem gesicherten Bestand des Bestehenden."
Auf eine Erkenntnis will ich, was die multikulturelle Szenerie jener achtziger Jahre in Kreuzberg anbelangt, noch hinweisen: In jener Zeit setzte sich Mesut Keskin Tag um Tag in ein Café am Paul-Lincke-Ufer und begann in seiner Dissertation die Geschichte des Scheichs Bedreddin zu erzählen: "Bedreddin versammelte im anatolischen Mittelalter im herrschaftsfernen Niemandsland zwischen Europa und Asien Häretiker, Sektierer, Mystiker, Entlaufene, Grenzgänger und schuf eine tolerante Hochkultur mit ihnen. Auch wenn die Armee der Zentralmacht irgendwann anrückte und den Scheich mit seinem Gefolge umbrachte – für Mesut Keskin ergab sich mit Blick auf einen der Glaubenssätze interkultureller Erziehung – "diversity is beautyful" – eine etwas andere These: das Amalgam ist es , die wilde Mischung aus allem."
Viertens: das Chaos in ungewohntem Milieu
Man kommt irgendwo hin, kennt sich nicht aus und verirrt sich. Nichts läuft nach Plan.
Nigel Barley beschreibt in seinem Buch "Traumatische Tropen", wie er als junger Ethnologe die Feldforschungsberichte von Kollegen bestaunte, die in einem möglichst hinteren Winkel der Welt einen möglichst unbekannten Stamm fanden und offenbar erfolgreich untersuchten. Barley suchte sich also auch seinen möglichst unbekannten Stamm in einem hinteren Winkel Kameruns, die Dowayos, und verhedderte sich vor und während seines Aufenthaltes in den Vorbereitungen zu seiner Forschung. Als er nach zwei Jahren wieder abfuhr, hatte er zwar keine ethnologischen Forschungserfolge im Gepäck, dafür aber hatten die Dowayos die Gelegenheit genutzt, einen verrückten britischen Ethnologen zu studieren. Immerhin, Barley hat die "Traumatischen Tropen" geschrieben, eine der witzigsten Abrechnungen mit Feldforschungsattitüden, die ich kenne.
Mir ist es, als ich Ende der siebziger Jahre auf Wanderschaft ging und mit dem Situationsansatz im Gepäck in Lateinamerika, Asien und Afrika arbeitete, nicht viel anders ergangen. Die Geschichten verliefen oft anders, als ich sie mir ausgedacht hatte. Die Verhältnisse, die Situationen, die Menschen scherten aus, und je mehr ich mich auf die Verhältnisse einließ, desto stärker hatte ich den Eindruck, dass ich nicht sie, sondern sie mich eines Besseren belehrten. Die chaotische, überraschende, brutale oder auch vergnügliche Wirklichkeit holte mich vom Ross, und erst weiter unten, in Bodennähe, wurde Sicht frei, öffnete sich mein Herz, erlebte ich den Sieg der Besiegten, verhedderte ich mich oder war glücklich, wenn eine kleine konkrete Utopie greifbar wurde.
Im Jahr 1986, sieben magere Jahre nach dem Sieg der Sandinisten über den Diktator Somoza, hatten sich in Nicaragua zwei Lager des Ministerio de Educación heillos zerstritten: Die Fraktion der Verschuler wollte Klassenzimmer für alle, Frontalunterricht für alle, einen Lehrplan für alle, einen, der detailliert vorschrieb, was am Donnerstag, den soundsovielten Mai von 10:00 bis 10:50 Uhr in allen fünften Klassen des Landes in Physik zu unterrichten sei: der Spülmechanismus einer Wassertoilette zum Beispiel, die kein Kind auf dem Land auch nur vom Augenschein her kannte. Die Gruppe der Verschuler hielt das für 'wissenschaftlich', und sie wurden damals von Margot Honecker und ihren Schulbürokraten unterstützt. Die Entschuler hingegen favorisierten ein Lernen in Bewegungen, in der Alphabetisierungs- oder der Gesundheitskampagne. Dengue-Fieber? Lasst uns die kleinen stehenden Wasserlachen in ausgedienten Autoreifen oder Blechbüchsen trockenlegen, denn die Mücken brauchen mindestens alle anderthalb Kilometer stehendes Wasser, um ihre Eier zu legen. Kein Wasser, keine Mücken, kein Fieber.
Das sei aber, sagten die Verschuler, ganz unwissenschaftlich. Denn wissenschaftlich sei nur, wenn man die Schulfächer als didaktisch aufbereitete und reduzierte Ausgaben der zugehörigen Wissenschaftsdisziplinen gestalten würde.
Dann würden sich aber die Schüler richtig langweilen, entgegneten die Entschuler, weil die akademischen Schulfächer mit der nicaraguanischen Wirklichkeit so wenig zu tun hätten wie eine Schildkröte mit einem Fahrrad.
Und so stritten sie sich. Als der Streit eskalierte, erhielt ich eine Anfrage des Ministers Fernando Cardenal, ob ich, da ich mit dem Ministerium doch schon seit 1979 zusammengearbeitet und mit Erzieherinnen nicaraguanische Schlüsselsituationen von Kindern recherchiert hätte, nicht als eine Art ehrlicher Makler kommen könne, um mit den zwei hadernden Fraktionen eine gemeinsame Lösung zu finden. Es solle eine zweiwöchige Klausur auf einem Berg namens El Crucero werden, nicht weit entfernt vom Kegel eines dampfenden Vulkans, in einer Villa, die eine frühere Geliebte Somozas fluchtartig verlassen hatte.
Ich hatte weiche Knie, als ich die 60 Mitarbeiter, junge Menschen von vielleicht 18 bis 30 Jahren, versammelt hatte. Die Frage war ja: Kann man wissenschaftlich und zugleich entschult lernen? Nach drei oder vier Tagen erregter Diskussionen schlug ich vor, den Austausch von Argumenten für eine Weile sein zu lassen und in einem Brainstorming nachzudenken, was die Hauptprobleme des Landes seien.
Dies geschah mit großem Einsatz und überraschendem Ergebnis: Alle Probleme begannen mit "falta de …", "Mangel an…" Ersatzteilen, Mangel an Nahrung … Das sei ja wunderbar, sagte ich ihnen, denn nun hätten wir die generativen Themen für die Struktur eines neuen, wissenschaftlichen, zugleich wirklichkeitsbezogenen, die Verbindung von Reflexion und Aktion fördernden Curriculum. Die neuen Schulfächer hießen nun nicht mehr "Mathematik", "Biologie" oder "Physik", sondern "Mangel an Energie und was man dagegen tun kann", "Mangel an Medikamenten und was man dagegen tun kann" und so weiter.
Nach vierzehn Tagen gab es die beiden Fraktionen nicht mehr, die 60 Nicaraguaner tanzten, lagen sich in den Armen und nahmen sich fest vor, das Curriculum des Landes auf diese Weise neu zu gestalten. Aber wie das nun so ist mit Revolutionen – die obwaltenden Umstände können sich verschlimmern, die Contra kann heftiger attackieren, das nordamerikanische Wirtschaftsembargo strangulierender wirken, kurzum: Nicht überall wurde das neue Curriculum entwickelt, aber doch in bemerkenswerten Beispielen.
Nicht alles war übrigens "Mangel an …". Es gab auch andere Probleme. Als ich gebeten wurde, mit erwachsenen Abendschülern darüber zu reden, warum sie sich bei der Unterrichtung des Sekundarschul-Lehrplans so langweilten, kam die Antwort, dass dieser Stoff mit ihren täglichen Problemen aber auch gar nichts zu tun habe. Ich fragte sie, ob sie mir ein Problem aus ihrem Alltag nennen könnten. Da sagten einige: "Die kleine sterbende Fabrik." Ich fragte sie, ob sie Lust hätten, ein Projekt mit dem Thema "Die kleine sterbende Fabrik und wie man sie wieder zum Leben erweckt" durchzuführen. Sie hatten Lust. Wir suchten eine kleine sterbende Fabrik am Rande der Stadt Managua aus. Ihre Geschichte war so: Ein Offizier der somozistischen Nationalgarde hatte einige Nähmaschinen gekauft und Näherinnen angestellt. Als die Sandinisten in Managua einrückten, floh er. Die zurückgebliebenen Näherinnen fackelten nicht lange, sondern machten sich selbständig. Aus dem Haus des Offiziers wurde eine kleine neue Fabrik. Die Frauen beobachteten den Markt und die Wünsche der Käufer und produzierten gute Ware, verkauften sie mit Erfolg, und ihrer kleinen Fabrik und ihnen ging es immer besser. Bis eines Tages ein junger Mann mit wichtiger Miene erschien und ihnen erklärte, die Stadt Managua habe beschlossen, alle kleinen privaten Fabriken ringsum unter städtische Leitung zu stellen; jetzt sei er der Leiter ihrer Fabrik und sie sollten von nun an Uniformen für städtische Bedienstete schneidern. Das taten sie ein paar Jahre, vergaßen ihre Vergangenheit und fühlten sich im sicheren Hafen. Dann aber erschien der junge Mann mit einer neuen Botschaft: Angesichts der schwierigen ökonomischen Verhältnisse könne die Stadt kein Geld mehr für Uniformen ausgeben, deswegen sollten die Frauen sehen, wie sie von nun an ohne städtische Aufträge auskämen.
Da hatten sie aber alles verlernt: den Markt zu beobachten, die Wünsche der Kunden zu erkennen, den Betrieb zu führen. Die kleine Fabrik schickte sich an zu sterben.
Als wir diese Geschichte recherchiert hatten, beschlossen die Abendschüler, der Fabrik wieder auf die Beine zu helfen. Sie ermutigten die Frauen zu kleinen Marktanalysen, ermunterten sie, wieder auf die eigenen Füße zu fallen und sich ihrer Fähigkeiten bewusst zu werden, die unter dem Geröll der städtischen Bürokratie verschüttet waren. Und so kam es, dass die kleine Fabrik eine neue Blüte erlebte und ich mir dachte, dass diese Geschichte einerseits irgendetwas mit dem Situationsansatz zu tun haben könnte, dass aber andererseits die Ereignisse andere Verläufe nehmen als man denkt, wenn man zum ersten Mal mit Abendschülern darüber redet, warum der Unterricht so langweilig ist.
Ortswechsel: Die nigerianische Provinz Badagry. Der Gouverneur hat darum gebeten, in Schulen zu recherchieren, warum dort chaotische Verhältnisse herrschen. In einer der Schulen zeigt sich, dass nicht nur Schüler, sondern auch Lehrer schwänzen. Einige von ihnen treffe ich auf dem Markt. Sie verdienen Geld. Andere sind überhaupt nicht zu sehen. Die Recherchen ergeben, dass viele von ihnen mit Schmuggeln über die Grenze nach Benin beschäftigt sind. Es ist ein Tom & Jerry-Spiel: Die Grenzpolizisten versuchen, die Schmuggler zu erwischen, um die Ware selbst zu verkaufen. Die Schmuggler bleiben am Leben, weil sonst der Nachschub stockt. Mir fällt ein, dass dieses Geschehen ein erstklassiges Angebot für Touristen sein könnte: Sie dürfen am Spiel teilnehmen und zahlen dafür. Nur würde das nicht die Quote des Schulbesuchs steigern. Deshalb lieber nachdenken, wie sich "learning & earning" verbinden lassen. Auf dem nahen Fluss treiben große Inseln aus Wasserhyazinthen vorbei. Ich erinnere mich an Khun Tuek in Bangkok, die womöglich als erste darauf kam, aus Wasserhyazinthen, kombiniert mit Rattan, schöne Möbel herzustellen, die man seither über die Projektwerkstatt GmbH beziehen kann: eine ökologische Wohltat, weil die Wasserhyazinthen wie eine grüne Pest das Leben in tropischen Süßwasserseen zerstören. Dem von der Provinzregierung Badagris bemerkten Chaos an den Schulen – besser: die einkommensgenerierenden Aktionen von Lehrern und Schülern jenseits dieser Schulen – müsste begegnet werden durch eine noch bessere Ökonomie in den Schulen: also ein abenteuerliches "learning" in Verbindung mit einem spannenden "earning" das mehr abwirft als Schmuggeln. ‑ Nicht so einfach.
Fünftens: das manchmal den Schlaf raubende, manchmal Glückseligkeit verheißende Entwicklungsgeschehen der School for Life in Chiang Mai
In das Projekt bin ich eher hineingestolpert, ohne am Anfang die Tragweite zu erfassen. Als meine Mutter mit 86 Jahren in Lindau erfuhr, dass sie Leukämie hatte und mitteilte, der Natur ohne ärztliche Interventionen ihren Lauf zu lassen, als viele Menschen sie in den verbleibenden Monaten besuchten und sich verabschiedeten, als es ihr trotzdem ein bisschen langweilig wurde, beschloss sie, in einer der großen Stadtkirchen Lindaus ein ökumenisches Konzert für Kinder im Kosovo zu organisieren. Gesagt, getan. Ungefähr sechs Wochen vor dem Konzert hörte sie auf zu essen. Wenige Tage vor dem Konzert, die Plakate hingen überall, standen wir vor ihrem Bett. Sie war mager und sehr schwach, dankte uns, schlief ein und wachte nicht wieder auf. Am Tag des Konzerts, im Juni 1999, war ihr Begräbnis. Zum Konzert kamen um die 1.000 Besucher, und es spielten und sangen etwa 100 Musiker jede Art von Musik. Die Besucher spendeten 20.000 DM. Unser Experte im Kosovo, David Becker, kam von dort nach längerer Zeit mit Skepsis zurück: Der Krieg sei aus, viele NGOs brächten viel Geld mit, und unsere Spende würde leicht versickern.
Als ich später mit einem deutsch-belgischen Filmteam in nordthailändischen Dörfern auf den Spuren von Aids-Infektionsketten unterwegs war und wir dort auf sterbende Eltern und verwaiste Kinder trafen, fragte ich meine Familie und Lindauer Spender, ob man das Geld nicht in Thailand einsetzen könne. Als mir zugestimmt wurde, begann eine neue Variante des halb beherrschten Chaos. Balinesische Professoren haben mir einmal erklärt, Balinesen würden nicht wie unsereiner linear, sondern in Spiralen denken. Viele Thais offensichtlich auch. Vom tiefen Westen her betrachtet, und noch ohne rechtes Verständnis für den Nutzen des Denkens in Spiralen (man riskiert weniger Frontalzusammenstöße!), wirkt das Management im "Thai style" wie ein durch spontan beschlossene Kurswechsel, spontan beschlossene Revisionen dieser Kurswechsel, unvermutete Prioritätensetzungen und ebenso unvermutetes Wiederaufheben dieser Prioritäten bestimmtes chaotisches, immerhin mit Vergnüglichkeiten durchsetztes Strömungsgeschehen, bei dem auch im Falle intelligenter Impulse von außen noch längst nicht geklärt ist, was am Ende dabei herauskommt. Ein Amalgam?
Man könnte sich diesem Stil überlassen wie ein Fisch in der Strömung, gäbe es nicht internationale Standards des Finanzmanagements, die Frage der Glaubwürdigkeit, der Transparenz, kurzum Standards, die abkühlend wirken können. Die Kunst besteht darin, zwischen – sagen wir – "family style" und "management style" irgendwo die immer noch wärmende Mitte zu finden.
In einer "Open Learning Community" (UNESCO) wie der School for Life mit bis zu 200 Seelen geschieht, auch wenn sich professionelle Managementstrukturen über die Jahre gefestigt haben, ständig Unvorhergesehenes: Es sind Einwirkungen von außen, wie die internationale Finanzkrise mit ihren Folgen für das Spendenaufkommen, die Besetzung des Flughafens in Bangkok durch die "Yellow Shirts", der Einbruch der Touristenzahlen infolge der innerstädtischen Blockaden der "Red Shirts" oder der Werteverlust der in Euro übermittelten Spenden – für einen Euro wurden nunmehr nicht mehr 50, sondern nur noch 37 Baht gewechselt. Die Verwerfungen der Welt werfen ihre Schatten auf das kleine Dorf, und der Zaubertrank dagegen ist nicht immer leicht zu finden.
Unvorhergesehenes entsteht aber auch von innen, und ich möchte Sie auf eine kleine schwarmtheoretisch erklärbare Begebenheit hinweisen, die die Folge eines Leitungsproblems war, mit dem wir uns eine Weile zu befassen hatten: Erst ging der eine Direktor, dann kam ein zweiter, ein Bürokrat ohne Zugang zu Kindern und Erwachsenen, dann ein dritter mit Visionen in der Art eines Gandhi, aber tatenlos. Und bevor wir einen Vierten fanden, und mit ihm hoffentlich zufrieden sein können, verwandelte sich das Lehrerkollegium in einen scheinbar führungslosen Schwarm, entwickelte eine kollektive Intelligenz, traf sich jeden Morgen und regelte die anstehenden Dinge.
Wenn man den Situationsansatz als eine Einladung versteht, Probleme in der Wirklichkeit (und nicht Scheinprobleme im Klassenzimmer) zu lösen und dabei zu lernen, dann wird er oft praktiziert, ohne dass den Beteiligten dies deutlich sein muss. Es ist ein Lernen im Blick auf kleine konkrete Utopien, der Versuch, sie zu verwirklichen und länger als einen Augenblick zu bewahren. Oder mit den Worten Ernst Blochs im "Prinzip Hoffnung":
"Man braucht das schärfste Fernrohr, das des geschliffenen utopischen Bewusstseins, um die nächste Nähe zu durchdringen."
Sechstens: das Chaos mit unerwartetem Ausgang
Paulo Freire war aus dem Exil nach Brasilien zurückgekehrt. Wir arbeiteten an der katholischen Universität von São Paulo zusammen. Es waren die späten achtziger Jahre. Einige führende Vertreter des Movimento Negro Unificado, der afro-brasilianischen Bewegung, hatten mir von ihrem Wunsch berichtet, dem immer noch rassistischen 'weißen' Curriculum brasilianischer Schulen ein schwarzes Curriculum entgegenzusetzen und es zusammen mit der schwarzen Bevölkerung Brasiliens zu entwickeln. Ich sagte, ich hätte zwar einige Erfahrungen darin, wie man ein Curriculum in einer Art Kampagne unter der Beteiligung vieler Menschen erarbeiten könne, aber ich hätte keine Ahnung, was ein schwarzes Curriculum sei. Da solle ich mir keine Sorgen machen, dazu hätten sie schon jede Menge Ideen, erwiderten sie. Ich fragte, wen sie alles zur schwarzen Bevölkerung zählten. Sie antworteten: alle, die nicht weiß seien und das seien mehr als 40% der Gesamtbevölkerung.
Nicht lange danach arbeitete ich mit einer afro-brasilianisch geprägten Schule an der südlichen Peripherie São Paulos an der Konkretisierung eines solchen Curriculum, ein Curriculum des pfiffigen Widerstands gegen die weißen Goliaths. Lehrer, Kinder, Eltern, Nachbarn und Miriam Caetano als Schulleiterin: Alle entwickelten intensiv und temperamentvoll mit – es war eine Mischung aus Werkstatt und Fest über mehrere Tage. Dann aber nahm die Geschichte eine andere Wendung: Eine Delegation von etwa zwölf Guarani-Indianern betrat das Schulgebäude, ließ sich schweigend auf dem Boden des Seminarraums nieder und beobachtete das Geschehen. Einen ganzen Tag lang. Sie schwiegen. Endlich aber stand einer auf, sagte, er sei Häuptling der Guaranis, sein Name sei Karai, und er wolle jetzt berichten, was ihr Problem sei und warum auch sie eine Schule des Widerstands bräuchten. Sie kämen aus einem Reservat in der Nähe von São Paulo, und weil die Stadt immer weiter wuchere und immer näher rücke, hätten weiße Grundstücksspekulanten damit begonnen, die Guarani-Indianer einzeln aus dem Hinterhalt zu erschießen. Sie, die Indianer, würden sich deshalb nur noch in Gruppen aus dem Reservat herausbewegen.
Was für eine Schule des Widerstands sie wollten? Eine mit Waffen, sagte Karai. Ich fand das aussichtslos, und deshalb entwickelten wir eine andere Idee: Die Guaranis könnten im Reservat eine indianische Akademie errichten, eine Akademie für die Rekonstruktion indianischen Wissens und dessen Verbindung mit modernem Wissen. So könne man zum Beispiel altes Wissen über Ökologie mit modernem zusammenführen, und das sei für viele Brasilianer und auch Gäste aus anderen Ländern so interessant, dass sie die Akademie im Reservat besuchen, durch Beiträge finanzieren und durch ihr Dasein die Spekulanten abhalten würden.
Gesagt und fast getan. Eine schweizerische Stiftung gab Geld. Die Indianer fingen an, ihre Akademie zu bauen, die Presse kam, erste Besucher meldeten sich an, aber dann kam alles ganz anders: Eine der großen Fernsehgesellschaften Brasiliens, "El Globo", erschien mit dem Plan, eine zweiundvierzigteilige "Novela" über die (erdachte) Liebesgeschichte zwischen der bildhübschen Tochter Karais und einem jungen weißen Brasilianer zu drehen. So geschah es, und als halb Brasilien diese Geschichte sah und die Presse Photos vom Reservat veröffentlichte, kamen und kamen immer mehr Menschen, die die Schauplätze des Geschehens sehen wollten. Aus war es mit der Akademie. Sie war nicht mehr nötig. Es reichte, Eintrittsgeld zu nehmen, um von den Besuchern zu leben. Aber wir hatten unser Ziel dennoch erreicht: Kein Spekulant schoss mehr, und Karai bedankte sich, als er mich Jahre später wieder traf, mit einer langen Umarmung. Mein Zauber sei wirksam gewesen, und er hätte es schon in der Schule der Miriam Caetano erahnt, dass sich die Dinge in die richtige Richtung entwickeln könnten.
Als Hermann Glaser, seinerzeit begnadeter Kulturdezernent der Stadt Nürnberg, und ich ein anderes Mal in Brasilien waren und die Schnapsidee entwickelten, 150 Vertreter der "cultura popular" aus Brasilien nach Deutschland einzuladen und sie für zwei Wochen mit Musikern, Malern, Autoren und Basisgruppen aus verschiedenen Städten zusammenkommen zu lassen, sagte er: Und wenn wir scheitern, dann bitte auf hohem Niveau. Den Satz habe ich mir gemerkt. Es kamen nicht ganz so viele Brasilianer nach Deutschland, aber immerhin, sie kamen in ziemlicher Zahl. Und jedes Mal, bevor sie in die nächste Stadt zogen, gab es ein großes Stadtfest mit Samba und Capoeira und Cachaça, und ich musste an die indianische Akademie denken und an Karai und seine Tochter und die bösen Spekulanten, denen wir das Handwerk gelegt hatten, und ich fand, dass Brasilien eigentlich überall sein könne, und dass man viel mehr erlebt, wenn die Geschichten ihre eigenen Wege einschlagen.
Wie kommt es, dass es manchmal klappt? Trotz des nur halbbeherrschten Chaos?
Günter Faltin hat einmal gesagt, ich sei jemand, der mit einer Anzahl von Begleitern am Ufer eines Flusses stünde und ihnen erklärte, dass drüben auf der anderen Seite das gelobte Land liege. Wir müssten nur eine Brücke bauen. Ich würde dann die ersten drei von fünfzehn Pfeilern mitbauen und – während sich meine Begleiter abmühten, die restlichen zwölf Pfeiler zu setzen ‑ mich von dannen machen, um an einem anderen weit entfernten Ort, wieder an einem Fluss und mit neuen Begleitern, das gelobte Land auf der anderen Seite zu preisen und so weiter und so weiter.
Ich danke allen von Herzen, die sich mit dem Pfeilerbauen abgemüht, die sich oft über die Maßen eingesetzt, die oft geschimpft, mich aber nicht auf immer und ewig verflucht oder verlassen haben.
Jürgen Zimmer anlässlich der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an ihn am 25.5.2010