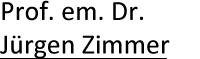Jürgen Zimmer
"Die Fliegende Universität"
Die Fliegende Universität_Jürgen Zimmer.pdf
„Du bist der faulste Professor, der mir je
untergekommen ist. Aber ich habe noch
nie so viel gelernt.“
Studentin beim Abschlusstreffen eines
meiner Seminare
„Auf die Barrikaden! Tod den
professoralen Schweinen! Tod dem
Jürgen Zimmer!“
Student, der mein Seminar über Paulo
Freire „Pädagogik der Unterdrückten“
besucht hatte, sich radikalisierte und
fand, ich würde die Freire´sche Theorie
der Verbindung von Reflexion und
Aktion nicht zureichend umsetzen.
Ich fand das nachvollziehbar, aber
nicht aufregend genug, um den von
der Universitätsleitung angebotenen
Schutz in Anspruch zu nehmen.
„Eine wirklich sehr gute Prüfungsleistung.
Glückwunsch!“
Mein Kommentar nach der mündlichen
Prüfung zum Hauptdiplom einer
Studentin, die sich ungefähr im 86.
Semester befand und davon zwölf Jahre
als RAF-Mitglied einsaß.
„Hallo Professorchen, Sie sind mein
Lieblingsprofessor, und ich will bei Ihnen
über Gewalt an Kindern in türkischen
Gefängnissen promovieren.“
Türkischstämmige Studentin, die es bei
diesem Wunsch belassen musste, weil die
türkische Justiz ihre Untersuchung
blockierte.
1. IN ERINNERUNG
Geboren am 19. Februar 1938. Erster Vater im Krieg gefallen. Zweiter Vater durch Suizid ausgeschieden. Mutter, Jugendleiterin, arbeitete nach dem Krieg auf dem Bauernhof. Als Flüchtlingskind Besuch der Volksschule in Wasserburg am Bodensee. Danach: Schule Schloss Hohenfels (Unterstufe von Salem), Melanchthonschule in Steintal / Hessen, Hermann Lietz-Schule Schloss Bieberstein, Gymnasium in Lindau (Bodensee), Abitur in Salem. Studium der Psychologie und Pädagogik in Hamburg, Freiburg und München.
1.1 PFROPF-SCHIZOPHRENIE
Universität München, Institut für Psychologie, 1962: Außer dem Ex-Nazi und Militärpsychologen Philipp Lersch gibt es den einen oder anderen klinischen Mitarbeiter, der der verschrobenen Persönlichkeitspsychologie des Professors Lersch nicht folgt. Einer von ihnen stellt mir einen Klienten vor, der ein sehr verstecktes Symptom habe; ich solle versuchen, dem in einer Anamnese auf die Spur zu kommen. Es dauert eine Weile, dann werde ich fündig. Ich beschreibe das Phänomen, der Kliniker ist hocherfreut und nennt die klinische Bezeichnung: Pfropf-Schizophrenie. Aha. Nie zuvor gehört, und danach auch nie wieder. Aber beeindruckend und in Erinnerung geblieben. Warum? Weil es ein wirklich herausfordernder Fall und kein didaktisch zubereiteter aus dem Lehrbuch war.
1.2 DIE GURRE-LIEDER
Alpbach / Tirol, um 1963: Die Studienstiftung des deutschen Volkes veranstaltet eine Sommerakademie. Wir Stipendiaten haben die Wahl zwischen verschiedenen Veranstaltungen. Ich wähle ein Seminar von Rudolph Stephan über die Gurre-Lieder von Arnold Schönberg. Ein Wahnsinnswerk der Spätromantik, komponiert von einem 27jährigen. Ohne Alpbach wären mir die Gurre-Lieder möglicherweise nie begegnet.
So aber öffnen sie die Türen zu Arthur Honegger („Jeanne d’Arc au bûcher“), Darius Milhaud („La création du monde“), Olivier Messiaen („Turangalila Symphonie“), zu Igor Strawinsky, Alban Berg oder Gustav Mahler. Das Seminar werde ich nicht vergessen. Es hatte nichts mit meinem eigenen Fach zu tun, sondern machte mich neugierig auf andere Welten.
Wasserburg am Bodensee, Haus auf der Pfannhalde, 1963 bis 1965: Alpbach hat eine Gruppe befreundeter Studienstiftler zu den Pfannhalden-Gesprächen angeregt. Die Regel: ein Thema an einem Tag, ein ganz besonderes. Eines, von dem die anderen keine Ahnung haben, und so dargeboten, dass die anderen alles verstehen und darüber diskutieren können. Zu den Themen gehören: „Die Mystik des Dominikaners Heinrich Seuse“, „Ribonukleinsäure und Desoxyribonukleinsäure“, „Ein indischer Sonnenkult“, „Die Diskussion um Willensfreiheit“ und anderes mehr. Jörg Drews, später Literaturkritiker der „Süddeutschen Zeitung“ und Professor für Literaturwissenschaft an der Universität Bielefeld, macht uns auf der Pfannhalde zu Fans der Konkreten Poesie des Gerhard Rühm, der Wiener Mundartgedichte des H.C. Artmann oder der kühlen Prosa des Peter Weiss („Der Schatten des Körpers des Kutschers“). Und dann: Arno Schmidt rauf und runter, vor allem „KAFF auch Mare Crisium“. „Zettels Traum“ war noch nicht erschienen, sonst hätten wir uns daran festgebissen. Seitdem finde ich die Erhabenheitsliteratur eines Hermann Hesse und Thomas Mann eher ungenießbar. Die Erinnerung an die Pfannhalden-Gespräche ist wach.
Warum? Weil sie eine damals vergessene, gleichwohl wichtige Einrichtung der Universität im kleinen Format wiederaufleben ließ: das Studium Generale.
1.3 Nutten und Nüttchen
Freie Universität Berlin, um 1993: In einer Sitzung des Fachbereichsrates Erziehungswissenschaft und Psychologie wird über die Vergabe von Lehraufträgen verhandelt. Ich habe zwei Vertreterinnen der Berliner Hurenbewegung, der Gruppe "Nutten und Nüttchen" als Lehrbeauftragte vorgeschlagen, beide mit akademischem Abschluss. Das Ziel: Vorbereitung von Studierenden der Sozialpädagogik auf die Arbeit mit Klienten der Berliner Halbwelt.
Der Verwaltungsleiter hält mit spitzen Fingern einen an ihn adressierten Brief hoch, der die Anträge der beiden enthält und liest den Absender vor: "Mit feuchten Küssen, die Zimmer-Girls". Ich schaue in die Runde der Kollegen und denke, na Jungs, hat jemand Angst, geoutet zu werden? Die beiden Aufträge werden angenommen.
Das Seminar, das Barbara Merziger, Maik Leffers und ich gemeinsam veranstalten, will nicht nur die Studenten auf ihre Arbeit vorbereiten, sondern auch Ideen entwickeln, wie man von der Prostitution in der Schmuddelecke herausfinden und das Berufsbild einer Sexpertin entwickeln kann, die zwischen Arzt und Psychologen angesiedelt, zur Daseinsbereicherung in Sachen Sexualität beiträgt. Dazu sollen die Studenten die Bedürfnisse von Menschen mit sexuellen Problemen ermitteln, in Altersheimen, Gefängnissen, psychiatrischen Anstalten; sie sollen mit Menschen mit Behinderungen oder mit Ehepaaren sprechen, deren Erotik versandet ist.
Großer Ansturm. Der Seminarraum ist viel zu klein. Wir ziehen in einen Hörsaal um. Unser Seminarziel rückt nach hinten. Zwei Phasen schieben sich nach vorn. Phase eins: Eine Gruppe von Studentinnen will vehement bestätigt bekommen, das Huren unglücklich seien. Wir aber nicht, sagen Maik und Barbara, die gerade über „Lachen und Sex“ promoviert. Und viele ihrer Kolleginnen aus der Hurenbewegung seien es auch nicht. Aber, sagt die Studentin Gülizar, man könne doch keinen Sex haben ohne zu lieben. Doch, sagen die beiden. Und einen Orgasmus bekämen sie auch. Gülizar schreit, das sei ja zum Kotzen, und rauscht raus (als wir uns Jahre danach trafen, war das Seminar immer noch ein Thema lebhafter Erörterung).
Phase zwei: Die Seminarteilnehmer bringen ihre eigenen Probleme zur Sprache. Barbara und Maik sind nunmehr als Sexpertinnen und - therapeutinnen gefragt. So vergeht das Semester, und erst im nächsten kommen wir, abermals mit Zustimmung des Fachbereichsrates, zum ursprünglichen Thema des Seminars.
Seminare über (und im) „Berlin Underground“: Die Stadt wird unterschichtet von Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung, von Obdachlosen, Straßenkindern, Gestrandeten, Halb- und Unterweltlern. Sozialpädagogen sind gehalten, dorthin zu gehen und nicht in ihren Diensträumen zu warten, bis jemand vorbeikommt.
Ich lade Studentinnen und Studenten ein, zwei, drei Tage in diesem anderen Berlin zu verbringen. Im „Wiener Stüberl“ in der Uhlandstraße habe ich mein Hauptquartier samt Hotline eingerichtet, weil es fast die ganze Nacht offen hat. Zu den Schutzengeln der studentischen Rechercheure gehören Santo und Uwe, beide Kampfsporttrainer – Santo, der Ex-Zuhälter, und Uwe, der Edelbordell-Manager. Sie sollen die Studentinnen vor allzu riskanten Aktionen bewahren.
Erstaunliches geschieht: Studentinnen stehen als ‚Huren‘ an der Straße des 17. Juni, lassen sich auf Gespräche mit Kunden ein und wimmeln sie, nachdem sie genug erfahren haben, ab. Andere besuchen ein Sado-Maso-Studio und hören den lebensphilosophischen Aufzeichnungen der Domina zu. Wieder andere besuchen eine Wohngemeinschaft mit männlichen Prostituierten und lassen sich erklären, warum diese Männer stets die ideale Frau suchen und nie finden. Ein Student setzt sich in einen Rollstuhl, bittet an U-Bahn-Eingängen, ihn herauf oder herunterzutragen und erlebt Merkwürdiges. In S-Bahnen geht es um paradoxe Interventionen, wenn irgendwelche Raudis Fahrgäste anpöbeln: einen epileptischen Anfall mimen, um die Täter-Opferbeziehung zu stören? Oder einen Partnerstreit laut vom Zaun zu brechen? Eine Studentin kommt gegen Morgen ins „Stüberl“ mit einem Obdachlosen im Gefolge: Sie wolle von ihm wieder ‚geschieden‘ werden, nachdem er sie vorher ‚geheiratet‘ hätte. Die Scheidung wird mit Szegediner Gulasch besiegelt.
In den Seminartreffen zwischendurch werden Theorien auf die verzwickte Wirklichkeit bezogen und auf ihre Aussagekraft geprüft. Die Untergrund-Rechercheure schreiben ihre Reportagen. Ich habe selten bessere Texte von Studierenden gelesen; dichte Beschreibungen, die das Erlebte und ein theoriegeleitetes Nachdenken darüber verbinden.
Die Quintessenz? Auf dem Campus in Dahlem findet kaum etwas von dem statt, was draußen fürs Studium von Bedeutung ist. Der Campus ist oft, mit Siegfried Bernfeld, der falsche Ort pädagogischen Bemühens.
1.4 DIE PROZESSION
Eine Sporthalle in Berlin-Ost Mitte der 1990er Jahre: Loddels mit langem Nackenhaar, Goldkettchen und maulkorbbewehrtem Kampfhund, Hells Angels mit ersten grauen Strähnen im Haar und deutlich jüngeren Freundinnen, hier eine Gang und dort eine Gang.
Die Ränge sind gut gefüllt, und die Stimmung schaukelt sich auf. Das Programm für diesen Abend: Kickboxen und K1, die Superklasse, die Kombination asiatischer Full-contact-Kampftechniken. Andi Hug, vormals ein schweizer Straßenjunge, der in Japan alle Gegner aus dem Ring schlug und K1-Weltmeister wurde, ist unter den Zuschauern; und André Mewis, Weltmeister im Kickboxen, wird mit in den Ring steigen.
Das Publikum wartet auf das Erscheinen der ersten beiden Kämpfer, auf Nebelschwaden und Pomp-Rock.
Nichts dergleichen.
Vielmehr ertönt Gamelan-Musik. Eine Tür öffnet sich und heraus kommt die balinesische Tänzerin Shanti. Sie führt eine Prozession an mit zwei Dutzend Kämpfern sowie Studentinnen, deren elegante indonesische Fashion nach Shantis Entwürfen aus den Fasern von Bananenstauden und Ananasstrünken gefertigt wurde. Studenten in balinesischen Gewändern flankieren den Zug mit balinesischen Schirmen.
In der Halle ist es still geworden. Im Ring lassen sich die Kämpfer entlang der Seile im Lotussitz nieder. Shanti meditiert in der Mitte des Rings. Die Kämpfer meditieren. Keine Musik. In der Halle ist es nunmehr mucksmäuschenstill.
Nun setzt die Gamelan-Musik wieder ein. Shanti führt einen balinesischen Willkommenstanz vor, hält eine Schale voller Blüten hoch, wirft die Blüten in alle vier Richtungen. Die Blüten fallen auf die Kämpfer. Die Prozession formiert sich erneut, zieht aus der Halle, und nur die beiden ersten Kämpfer bleiben im Ring zurück. Langanhaltender Beifall. Selbst die Hells Angels sind berührt. Es hätte auch gnadenlos schief gehen können. Bei paradoxen Interventionen lässt sich schlecht voraussagen, was dann an Reaktionen kommt.
Die Prozession ist Teil eines Seminars, das sich mit der Frage befasst, ob Kampfsport jugendliche Gewalttäter zivilisieren könne. Unsere Antwort: ja,
•wenn zugleich die fernöstliche Philosophie gelehrt wird,
•wenn Fairness zur Regel wird, insbesondere dann, wenn der Gegner besiegt wurde,
•wenn die Würde des Gegners respektiert wird,
•wenn interkulturelle Kompetenz und Toleranz vermittelt werden,
•wenn später Berufe vermieden werden, deren Settings zu erneuten Schlägereien anstiften.
Zur Vorbereitung des Seminars treffen sich Andi Hug, André Mewis, die Trainer Uwe und Santo, Shanti und ich in Berlin-Steinstücken. Andi, der Friedfertige, erzählt von seinem langen Weg zur Spitze. Wir schauen uns auf einem Video den Auftritt Andis in der Late Night Show von Thomas Gottschalk an: wie er mit der Handkante mehrere übereinandergestapelte Eisblöcke in Stücke schlägt, mit einem Tritt einen Baseballschläger in zwei Teile zerlegt und damit eine anwesende Psychologin zu Ausrufen des Entzückens animiert.
André, der früher brutale Schläger aus dem Kreuzberger Hinterhof, erzählt eine traurige Geschichte mit gutem Ausgang: Er war nach Jakarta zur Weltmeisterschaft im Pencak Silat eingeladen, der indonesischen Variante des Kampfsports. Die Organisatoren hatten von der Begabung Andrés gehört und befürchteten, dass er sich bis zum Weltmeistertitel durchsetzen könnte. Im ersten Kampf konfrontierten sie ihn mit einem der besten Kämpfer und hofften, ihn frühzeitig auszuschalten. André gewann, aber das korrupte Kampfgericht sprach den Sieg seinem Gegner zu.
André verließ die Arena und lief mit Tränen in den Augen ziellos herum. Der Fall kam unmittelbar nach dem Kampf vor das oberste Gremium des Pencak-Silat-Verbandes.
Man erkannte den Skandal, holte André zurück, ernannte ihn zum Sieger und ließ ihn weiterkämpfen. Er wurde Weltmeister. Während André später in Berlin ein Kampfsportstudio eröffnete und schlagwütige Jugendliche von der Straße holte, wurde Andi in Japan vermutlich von der japanischen Mafia ermordet. Er, der Held einer Andi-Comic-Serie mit Millionen-Auflage wollte in die USA und dort den Fußstapfen des Filmstars Arnold Schwarzenegger folgen. Dies sollte offensichtlich verhindert werden.
Das Seminar, das die Studierenden des Lehramts und der Pädagogik in eine ganz andere Welt führte, die Welt des Milieus und der harten Bandagen, hatte viele Folgen: von den von Studenten gewählten Prüfungsthemen über Diplom - und Magisterarbeiten bis hin zu ein oder zwei Dissertationen.
Und weil die Studentinnen und Studenten mehr über das ‚Milieu‘ wissen wollten, zogen wir, einem Vorschlag Santos folgend, in die Katakomben von Wandlitz. Dort war ein Tunnel in einen Schießstand verwandelt worden, und dort schoss das ‚Milieu‘ Waffen ein. Die Studierenden schauten, staunten und begnügten sich mit leichteren Handfeuerwaffen, und wenn ich mich recht erinnere, trafen die Studentinnen besser als die Studenten. Zu den Erfahrungen des Seminars gehörte die, dass man mit Vertretern der Halbwelt umso besser kommunizieren kann, je mehr es gelingt, durch die Fassade des großen Zampano hindurch den Kern der Person zu erreichen, die idealtypische Linie, sozusagen das innere Kind. Und dass es dann erstaunlich ist, wie freundlich Menschen miteinander umgehen können, statt sich in Eskalationen der Gewalt zu verstricken.
1.5 ZUCKER IM TEE
Freie Universität Berlin, zweite Hälfte der 1980er Jahre: Ein Seminar mit viel zu vielen Lehramtstudenten. Pflichtschein zum Thema „Interkulturelle Erziehung und Bildung“. Mein Partner ist der Kollege Gerd Hoff.
Das Standard-Seminarmuster – Referat, Diskussion, Referat, Diskussion und so weiter – funktioniert sowieso nicht. Eine Vorlesung daraus machen und am Ende eine Klausur schreiben? Langweilig.
Wir machen es anders. Wir sagen: Ihr könnt in Berlin-Kreuzberg eine zweitägige interkulturelle Konferenz organisieren. Die wird am Wochenende in einer dann leeren Schule an der Skalitzer Straße stattfinden. Zwischendurch werden wir uns einige Male treffen, um die Workshops in Ziel und Struktur zu besprechen. Ihr schließt euch zu kleinen Gruppen zusammen. Jede Gruppe organisiert einen Workshop, auch mit sachverständigen Gästen von außen. Die einen Gruppen bieten ihre Workshops am Samstag, die anderen am Sonntag an. Wer an einem der beiden Tagen keinen Workshop veranstaltet, ist aktiver Teilnehmer bei den Workshops der anderen.
Intensive Diskussion, als es um die Bildung der Teams, die Bestimmung der Themen und ihre Verteilung geht: „Frauen im Islam“, „Interkulturelle Community Schools“, „Interkultureller offener Unterricht“, Koordinierte zweisprachige Erziehung“, „Analyse türkischer Videos“, „Asylbewerber in Berlin“, „Alltäglicher Rassismus“, „Lehrerbildung in türkischen Dorfinstituten“, „Gib mir mal ´nen Ekmek: code switching“, „Deutschland als Einwanderungsland“, „Vom katholischen Mädchen auf dem Land zum türkischen Mädchen in Kreuzberg“, und viele Themen mehr.
Während der Konferenz mit vielen Gästen von außen - türkischstämmige Lehrer, Flüchtlinge, Migrationsbeauftragte oder Religionsgelehrte – übernehmen Gerd Hoff und ich die Rolle von zwei Wanderern. Wir wandern von einem Workshop zum anderen, hören zu, machen mit und überzeugen uns von der Vielfalt und Fundiertheit der Angebote und der intrinsischen Motivation, mit der die Teams ihre Workshops gestalten.
In jener Zeit ist Mesut Keskin Stammgast in einem Café am Paul-Lincke-Ufer und scheibt an seiner Dissertation über den weisen Scheich Bedreddin (1358-1420), der im anatolischen Mittelalter in der herrschaftsfernen Grenzregion zwischen Europa und Asien Flüchtlinge, Migranten, Ketzer, Sektierer und Abweichler um sich versammelte und eine Hochkultur schuf, bis die osmanische Herrschaft darauf aufmerksam wurde und ihre Armee in mehr als einem Anlauf den Scheich und seine Anhänger zur Strecke brachte. Die Hochkultur entstand, weil keiner so blieb, wie er war. Alle entwickelten sich im Geiste der Toleranz weiter. Mesut Keskin verglich das mit einem Glas Tee und einem Stück Zucker: Wenn sich der Zucker im Tee auflöst, ist weder der Tee noch der Zucker so wie vorher.
Also keine interkulturelle Erziehung, die darauf setzt, dass jeder bei sich selbst bleiben möge, sondern eine, die ein Amalgam fördert, das neue Perspektiven eröffnet. Seminare dieser Art dienen nicht der Inszenierung kultureller Museen, sondern wollen die Bildung von kulturellen und sozialen Amalgamen fördern. Und auch die Studenten sind, wenn es gut geht, danach nicht mehr ganz so wie sie vorher waren.
1.5 DIE REISE NACH JERUSALEM
Westanatolien, Türkei, 1979: Wir Professoren des künftigen Instituts für Interkulturelle Erziehung und Bildung haben uns mit mehreren Dutzend Studenten auf anatolische Dörfer verteilt, um im Herkunftsland die Kultur und Situation türkischer Einwanderer zu studieren. Dem Dorf, das meine Gruppe aufnimmt, steht ein an Burt Lancaster erinnernder Bürgermeister vor, der der letzte Überlebende in einer Kette von Blutrache-Akten ist. Kaum angekommen, beobachten wir zwei zehn- bis zwölfjährige Jungen, die in festlicher, uniformähnlicher Kleidung auf Eseln durchs Dorf geführt und in einen Raum gebracht werden, in dem Männer und Frauen dichtgedrängt auf ein Ereignis warten: die Beschneidung. Ein deutsch-türkischer Student erklärt und übersetzt. Zwei Beschneider, zwei - wie sich bald herausstellt – arge Dilettanten, streiten über die Frage, wer darf und wer nicht darf. Dann befassen sie sich mit den Jungen.
Die schreien wie am Spieß. Einer deutschen Studentin wird schlecht. Die Frauen im Raum indessen lachen und reißen Witze: keine Happy Hour für Männer.
In den Wochen danach erleben wir eine überwältigende Gastfreundschaft. Wir lernen viel und arbeiten mit. Nur zurück nach Berlin können wir nicht. Ein Militärputsch hat die Schließung der Grenzen zur Folge. Nun sind wir Gäste unversehens zu Gastarbeitern geworden. Die Erkenntnis ist beklemmend: dass der Herzlichkeit unserer Aufnahme eine Kaltschnäuzigkeit gegenübersteht, mit der Gastarbeiter in unserem Land rechnen müssen.
Als die Grenzen wieder offen sind, naht der Abschiedsabend. Wir haben uns überlegt, welches Spiel wir so spielen können, dass der Bürgermeister gewinnt. Es ist die „Reise nach Jerusalem“. Wir haben vorher geübt.
Als der Bürgermeister auf dem letzten Stuhl sitzt, freut er sich mächtig, und wir freuen uns mit ihm. In Westanatolien haben wir mehr gelernt, als in Campus-Seminaren. Wir waren am richtigen Ort.
1.6 SMOKEY MOUNTAIN
Manila, Philippinen, 1986: Ich halte nicht viel von langatmigen landeskundlichen Vorbereitungen, bevor es in die weite Welt geht. Erste kulturelle Schocks an Orten des Geschehens sind lernintensiver. Wenn Studenten vom Airport Manila in Jeepneys direkt zu ihren Unterkünften in Tondo, einem Slum in der Nähe des Smokey Mountain gebracht werden, wenn Fliegen sie umschwärmen und der Gestank des kadavergleichen, qualmenden Müllbergs ihnen den Atem nimmt, dann erhalten sie einen ersten Eindruck vom Leben in Armut, und sie kommen auf bessere Ideen, eine ‚Productive Community School‘ mitzuentwickeln, die ‚learning & earning‘ miteinander verbindet. Sie begreifen, dass die müllsammelnden Kinder oben auf dem Berg keine Schule besuchen würden, in der sie nichts verdienen.
Ein Workshop mit Studenten aus Berlin und Straßenkindern in Ermita, Manilas Rotlichtbezirk. Mit dabei sind Mädchen aus den GoGo-Bars, der korrupte Bezirksbürgermeister, Polizisten und Sozialarbeiter. Die Konturen einer ‚Productive Community School‘ entstehen, die die Gestalt eines Abenteuerrestaurants annehmen soll.
Die Kinder, die über ihre Kunden allerhand über die Welt erfahren haben, kommen auf die besten Ideen zur Gestaltung des Restaurants: hier eine italienische Ecke, in der man den Teig durch eine Nudelmaschine schickt und die Spaghetti selbst herstellt, dort die koreanische Ecke mit glimmenden Kohlen und einem Rost zur Zubereitung von Bulgogi; die kanadische Ecke mit BBQ am Lagerfeuer; und dazu die Köstlichkeiten aus der philippinischen Inselwelt.
Als das Restaurant „Hapag Kalinga“ einige Monate später eröffnet wird, sind Berliner Studenten dabei, planen mit, richten mit ein, trainieren die Kinder und spielen die ersten Gäste. Die Kinder der Armen als Unternehmer verstehen: Das war das Ziel des Seminars, das nur an einer der sozio-ökonomischen Peripherien stattfinden konnte.
1.7 VIVA SANDINO
Managua, Nicaragua, 1981: „Ein Volk in Familienbesitz“. Die Geschichte des Landes und seiner Revolution kennen die Studenten aus ihrer Beteiligung an Solidaritätsaktionen im Vorfeld der Reise. Während ich mit einer Abteilung des Ministerio de Educación zusammen an der Entwicklung eines realitätsnahen Curriculum arbeite, wollen die Studenten ein paar Fahrstunden außerhalb Managuas mit Dorfbewohnern zusammen eine Schule bauen. Wir, zwei Mitarbeiter des Ministeriums und ich, bringen sie auf einem Lastwagen hin. Sie kommen in einer geräumigen Hütte unter. Die Frau, die sie versorgen wird, bitten wir eindringlich, das Trinkwasser vorher abzukochen. Am ersten Abend, ich bin schon auf dem
Weg zurück nach Managua, feiern die Bewohner des Dorfes mit den Studenten ein Willkommensfest. Als die Studenten in der Nacht zur Hütte zurückkommen, warten hungrige Schwärme von Insekten auf sie. Sie hatten vergessen, das Licht auszumachen. Die Köchin hat unter „abkochen“ „warm machen“ verstanden, und als ich nach einer Woche wiederkomme, finde ich eine von Durchfall und Moskitostichen geplagte Mannschaft. Also wieder rauf auf den Lastwagen und ab zur pazifischen Küste. Dort bleiben wir eine ganze Weile.
Und während die Studenten wieder gesund werden, findet ein Seminar im Sand über wichtige Themen der sandinistischen Bildungspolitik statt: die Alphabetisierungskampagne, die Consulta Popular, die „escuelas en el campo“, Lernen in Kampagnen am Beispiel der Gesundheitskampagne, Lehrerbildung, zentrale versus dezentrale Curriculumentwicklung, die Einführung vorschulischer Erziehung auf der Grundlage des Situationsansatzes.
Danach wird die Schule weitergebaut und fertiggestellt. Die Studenten werden im Ministerium vom Bildungsminister Carlos Tünnermann-Bernheim empfangen und als Helden der Aufbauarbeit und Meister in der Bewältigung schwieriger Umstände gefeiert. Die Studenten erhalten auf Rindsleder geprägte Urkunden, die, wenn sie nicht verloren gingen, heute noch an die glorreiche Zeit erinnern.
1.8. JENSEITS DER SÜMPFE
Accra, Ghana, 1996 : Das Ministry of Education veranstaltet zusammen mit dem Goethe-Institut und der Freien Universität ein einwöchiges Seminar zur Förderung von vorschulischer Erziehung auf dem Land: der Situationsansatz in Ghana. Vielleicht 50 oder 60 Frauen aus verschiedenen Provinzen nehmen teil. Viele von ihnen wollen einen Kindergarten in einer Gegend gründen, in der es noch keinen gibt. Studentinnen aus Berlin sind mit dabei. Sie und ich bevorzugen Seminare, die zu sinnvollen und nützlichen Ergebnissen führen können. Hier: ein vorschulisches Curriculum, das von Schlüsselsituationen der Kinder auf dem Land ausgeht und den Teilnehmerinnen selbst erarbeitet wird.
Drei Kulturen treffen aufeinander: erstens die Kolleginnen vom Ministerium mit ihren Vorstellungen von Plastikkindergärten mit Funktionstrainingsprogrammen – sie finden wenig Widerhall; zweitens die Landfrauen, die zunächst die Vorstellung haben, ein Kindergarten sei dann einer, wenn man 84 Kinder in den Raum einer Hütte zwängt und ihnen etwas eintrichtert; drittens die Studentinnen, die sich über den autoritären Stil eines vom Ministerium zuvor gezeigten Musterkindergartens ereifern.
Die Schlüsselsituationen, die die Teilnehmerinnen ermitteln, sind anders als anderswo. Zwei Beispiele: „Verlaufen im Busch“ thematisiert das Problem, dass Kinder sich im dichten Gehölz verirren können und eine Variation von Schreien lernen sollen, die suchenden Erwachsenen nicht nur die Ortung erleichtern, sondern auch die Situation des Kindes kenntlich machen – von „hallo, hier bin ich“ bis „Schlange beißt gleich“.
Zweites Beispiel: „Tabu“. Mädchen und Frauen der Provinz A essen kein Hühnerfleisch, die der Provinz B aber schon. Im Seminar entspinnt sich zwischen den Teilnehmerinnen aus beiden Provinzen eine lebhafte Diskussion. Es stellt sich heraus, dass die Männer in der Provinz A ihren Frauen das Tabu eingeredet haben, um die Hühner alleine zu verspeisen. Die Frauen aber wollen nach ihrer Rückkehr den Männern die Meinung sagen und auch Hühner essen.
Drei Studentinnen waren schon einige Zeit vor dem Seminar angekommen und hatten sich am Strand drei muslimische junge Männer geangelt. Beach Boys? Wohl mehr als das. Sie luden die Studentinnen ein, mit in ihre Dörfer jenseits der Sümpfe zu kommen, dort sollten sie den Familien vorgestellt werden. Als das Seminar beendet war, folgten die Studentinnen der Einladung. Zwei von ihnen erkrankten an Dengue-Fieber und überlebten es unter medizinfernen Umständen. Sie kamen zurück, vergnügt und doch durcheinandergewirbelt, und verwundert über das, was sie ihn Ghana erlebt hatten.
2. DER STAUB IN DEN TALAREN
Soll die Universität sich so weiterentwickeln, als Auszug aus dem Campus, als Suche nach den rechten Orten des Geschehens, als Flucht in die Wirklichkeit? Die Universität? Gewiss nicht. Ich habe Respekt vor Fakultäten und Forschungseinrichtungen, die andere Akzente setzen. Nur: Mir liegt es nicht, im Elfenbeinturm zu bleiben, und meinen Studenten auch nicht. Und wenn wir uns unsere Universitätsreform vorstellen, ein dynamisches, immer in Bewegung bleibendes Lehr-/Lern-Geschehen mit systematischen und situativen, miteinander verzahnten Partien und einem engen Theorie-/Praxiszusammenhang, dann wirkt die bestehende Universität, die ich erlebt habe, wie eine Meisterin der Selbstfesselung.
Es war die Langeweile des Campus, die nur dann unterbrochen wurde, wenn die Studenten streikten und die Gebäude besetzt hielten. Es waren die Prüfungen mit den immer gleichen Themen – am schlimmsten die Lehramtsprüfungen, in denen zwei Professoren, die nichts miteinander am Hut hatten, zwei miteinander unverbundene Themen eine halbe Stunde lang abfragten. Es war die Wochen - und Tagesstruktur mit dem Zwei-Stunden-Raster, den DiMiDo-Professoren, ereignislosen Seminaren, anonymen Studenten, die auftauchten und wieder verschwanden, Sprechstunden mit Abfertigungen im Fünf-Minuten-Takt, Instituten mit zusammengewürfelten Besatzungen, Gremien mit Konflikten über professorale Kleinterritorien, der Verlust von Ritualen wie dem ‚Graduation Day‘ (stattdessen die lieblose Abholung des Abschlusszeugnisses im Sekretariat des Prüfungsamtes), die Entdeckung der Langsamkeit durch die Universitätsverwaltung unter anderem in der Drittmittelverwaltung, und seit ‚Bologna‘ die Verschulung der Lehre als Fortsetzung einer nichtreformierten gymnasialen Oberstufe. Das muffelt. Der Staub der Talaren hält sich.
3. IN SITUATIONEN LERNEN
Das intensivste Lernen - so Ivan Illich - geschehe nicht durch Unterweisung, sondern durch die ungehinderte Teilhabe an relevanter Umgebung. Der Situationsansatz, angestrebter Bezugsrahmen der Carl Benz Academy, will diese Umgebung bereitstellen. Ein Curriculum strukturiert sich dann nicht nach Fächern oder Wissenschaftsdisziplinen, sondern nach Schlüsselsituationen und - problemen.
Ein Beispiel: In Nicaragua gab es Mitte der 1980er Jahre einen heftigen Streit im Ministerio de Educación: Die eine Gruppe, die der Verschuler, forderte einen zentral formulierten, nach Fächern gegliederten Lehrplan, möglichst ‚teacher proof‘, der von den Lehrern in frontaler Unterweisung exekutiert werden sollte. Die ‚Entschuler‘ favorisierten ein Lernen in Kampagnen und verwiesen auf die positiven Erfahrungen mit der
Alphabetisierungskampagne. Als ich vom damaligen Minister Fernando Cardenal gebeten wurde, diesen Streit möglichst zu schlichten, zog ich mit 60 Mitgliedern des Ministeriums auf einen Berg in die leere Villa einer Geliebten des geflohenen Diktators Somoza. Dort blieben wir zwei Wochen. Gegen Ende dieser Zeit lagen sich alle in den Armen und waren einer Meinung. Was war geschehen? Wir hatten uns darauf geeinigt, in einem großen Brainstorming die gegenwärtig wichtigsten Probleme des Landes herauszufiltern und sie zum Ausgangspunkt der Curriculumentwicklung zu machen. Die Probleme begannen alle mit „falta de…“, „Mangel an…“, also zum Beispiel „Mangel an Energie“, „Mangel an Nahrungsmitteln“, „Mangel an Medikamenten“, „Mangel an Ersatzteilen“. Und nun lag auf der Hand, die neuen Schulfächer, die eigentlich keine mehr waren, nach diesen Problemen zu benennen: also zum Beispiel: „Mangel an Energie, und was man dagegen tun kann“. Das führt dann zu Fragen, die beantwortet werden wollen: „Wie können wir in einem Dorf, das an Holzmangel leidet, unter lokalen Bedingungen Solarkocher oder eine Biogasanlage herstellen?“ Die Antwort auf „Mangel an Medikamente“ wäre dann „Wir pflanzen unsere Apotheke selbst an“. Lernen bleibt im Fluss, weil sich die Problemstellungen verändern können und neue Lösungen zu finden sind.
Für die Bearbeitung solcher Fragen und Probleme ist wissenschaftliches Wissen ebenso bedeutsam wie Erfahrungswissen. Das benötigte wissenschaftliche, oft interdisziplinäre Wissen wird den - nun einem Steinbruch der Erkenntnis ähnelnden – Bezugsdisziplinen entnommen. Dies Wissen wird herangeholt, um das eigene Projekt voranzutreiben. Es gehört zu den fachdidaktischen Mythen, dass die fachimmanente Systematik im Lernprozess wieder abgebildet werden müsse, dass also – um dies am Beispiel eines Buchs zu verdeutlichen – das Kapitel 16 nicht einfach genutzt werden kann, ohne vorher die Kapitel 1 bis 15 durchgenommen zu haben. Stimmt oft nicht.
Schon Shaul B. Robinsohns Strukturkonzept der Curriculumrevision hat den Weg andersherum gezeigt: erst die Identifikation und Analyse der Situation, danach und im Blick auf die Situation die Bestimmung von wünschenswerten Qualifikationen, und schließlich – erst dann – die Suche nach geeigneten Inhalten.
Der Situationsansatz überspringt nicht nur die Grenzen der Disziplinen, er beansprucht auch andere Zeiten. Es wäre nicht zielerreichend, das Thema „Mangel an Ersatzteilen, und was man dagegen tun kann“ in einem im Wochenrhythmus stattfindenden, zweistündigen Seminar abzuhandeln. Wie lange ein Team aus Schülern und Studenten braucht, um in Zeiten der finanziellen Verknappung in Managuas Krankenhaus die Kontrastflüssigkeit im Röntgengerät einem Recycling zu unterziehen und sie wiederzuverwenden, statt überteuert zu importieren, lässt sich schlecht prognostizieren. Das Projekt ist erst dann abgeschlossen, wenn das Problem gelöst ist.
‚In Situationen lernen‘ bedeutet dann, sich nicht durch verdinglichte Semesterstrukturen ausbremsen zu lassen, sondern in Teams zu forschen und zu handeln und flexible kleine Universitäten in der großen zu bilden. Die Teams können sich über Orte und Zeiten verständigen, sie werden nicht mehr wie Gulliver bei den Zwergen durch die Stricke einer Wissenschaftsverwaltung am Boden gehalten.
4. IN DIE RICHTIGE RICHTUNG: DIE CARL BENZ ACADEMY
Eine gute Idee: Studenten – im Hauptberuf Manager in der Automobilbranche – klinken sich aus ihrem beruflichen Alltag ein Stück weit aus und studieren in drei Ländern. Ihre Profession haben sie bisher nur empirisch gelernt, ihnen fehlt ein systematisches, theoriegeleitetes Wissen. Die Carl Benz Academy ermöglicht dieses Studium. In China, den USA und Deutschland treffen die Studenten auf unterschiedliche Kulturen, Lehrinhalte und Lehrstile. ‚Blended Learning‘ bedeutet für sie den Wechsel zwischen begleitetem E-Learning und Präsenzveranstaltungen. Das Studium professionalisiert, fördert die interkulturelle Kompetenz und erweitert den Blickwinkel.
Eine qualitative Evaluation der Carl Benz Akademie förderte zunächst viel Lob zu Tage. Es handle sich um eine brillant idea of tri-country collaboration, schreibt einer der Professoren; the best element has been the cross-cultural ‚meeting of minds‘ between faculty and students, meint ein anderer.
Auf dem Weg zur Fliegenden Universität, dem Flug aus Asche und Staub, sind - mehr noch als Lob - einige Hürden, Stolpersteine und Strukturprobleme der Carl Benz Academy von erkenntnisförderndem Interesse. Ist der Wein in den neuen Schläuchen der Academie frisch, alt oder eine Melange?
4.1 DAS BOXEN-CURRICULUM
Man kann ein Hochschul-Curriculum auf verschiedene Art entwickeln: zum Beispiel von generativen Themen aus oder von Wissenschaftsdisziplinen her. Wer ein Curriculum von generativen Themen aus entwickelt, muss sie zunächst einmal identifizieren und sich eine Theorie über sie bilden. Im Situationsansatz wird das die Situationsanalyse genannt. Sie ist der erste Schritt der Curriculumentwicklung.
Im zweiten Schritt geraten die wünschenswerten Qualifikationen ins Blickfeld: Situationen wollen nicht nur bewältigt, sondern auch gestaltet werden. Im dritten Schritt werden die Curriculum-Inhalte erarbeitet, die die Qualifikationsprozesse fördern können.
Im Situationsansatz werden – im Unterschied zu Robinsohns Strukturkonzept, das nur auf Experten setzte – die in den Situationen Handelnden in den Entwicklungsprozess eingebunden. Sie wirken mit, wenn es um die Identifizierung und Analyse von Situationen oder um die Auswahl und Aufbereitung von Inhalten geht.
Die Curriculum-Module der Carl Benz Academy sind nun nicht das Ergebnis eines solchen Entwicklungsgeschehens, vielmehr entstammen sie der universitären Asservatenkammer. Ihre Auswahl wurde mitbestimmt durch die Anforderungen und Lehrinhalte akkreditierter MBA-Studiengänge. Ihnen ging keine fundierten Situationsanalyse im beruflichen Umfeld der Studenten und ihrer Arbeitgeber voraus. Vielmehr wählte eine Planungsgruppe aus
Vertretern der drei Studienorte Module und Lehrende aus und unterstellte – besser: hoffte, mit diesen Modulen den Qualifikationsbedarf und das Erkenntnisinteresse der Studenten zu treffen.
Die qualitative Evaluation ergab, dass die Studenten die Relevanz der Module unterschiedlich einschätzten, dass sie den Zusammenhang zwischen den Modulen oft nicht sahen, sie vielmehr isoliert voneinander erlebten. Im Bild: Sie wurden von einem Boxenstopp zum nächsten geschickt, jeweils von einem Professor oder Dozenten in Empfang genommen und über einen reichlich knappen Zeitraum begleitet, von Hochschullehrern, die sie vorher nicht kannten und hinterher nicht (oder allenfalls beim Examen) wiedersahen. Ein bißchen erinnert das an ein blow up der Skinner´schen Vorstellung vom kleinteiligen, gleichsam atomisierten Lernen, dem der Gesamtzusammenhang abhanden kommt.
Auf die Frage an die Professoren, wie es ihnen dabei ging, kam die Antwort des Routiniers, es sei doch ganz üblich, mit einer ihnen unbekannten Gruppe von Studenten konfrontiert zu werden, ihnen den Stoff zu vermitteln und sie danach wieder aus den Augen zu verlieren. Andere Professoren wiederum fühlten sich isoliert und wussten weder, was die Kollegen nebenan oder gar an anderen Standorten machten.
Es sei, äußerten sie, ein Gefälle zur Peripherie hin feststellbar: Sie, die Professoren, hätten sich lediglich als Ausführende erlebt, sie seien aber weder in die Entscheidungen über die Auswahl der Module, noch in die Gestaltung der Struktur des Curriculum, noch in eine mögliche Verzahnung der Module, noch in die wechselseitige Abstimmung der Lehr-/Lernmethoden eingebunden gewesen.
So entstand ein pittoreskes Patchwork: eine Vielzahl von Boxen in drei Kontinenten, Professoren in diesen Boxen und Studenten, die ihre Boxenstopps absolvierten. Auch dazu gibt es Reminiszenzen: zum Beispiel an das Begräbnis der Idee von der integrierten Gesamtschule durch die Berliner Mittelstufenzentren der 1970er Jahre, die ihre 2.500 Schüler in vier Leistungsniveaus (FEGA) alle 50 Minuten wie auf einem Verschiebebahnhof umschichteten.
Die Boxen-Professoren haben angesichts ihrer schmalen Zeitfenster keine oder nur wenige Chancen, Praxisbezüge herzustellen, die unmittelbarer erfahrbar sind als in Büchern abgedruckte Fallstudien. Der von Studenten vielfach geäußerte Wunsch, sich an realen Fällen zu erproben, und zum Beispiel „consulting“ zu betreiben, würde ein Zeitmanagement voraussetzen, welches die Praxisintervention so lange ermöglicht, bis der Fall geklärt ist. Wenn die Business School der University of California (L.A.) Studenten, die vor dem Abschluss stehen, Teams bilden lässt, die sich reale Problemstellungen vornehmen und in einem dieser Fälle einem in Turbulenzen geratenen mittelständischen chinesischen Unternehmen vor Ort solange zur Seite stehen, bis die Firma wieder auf Erfolgskurs ist, und wenn das studentische Team darüber dann eine gemeinsame Abschlussarbeit schreibt, dann zielt diese Hochschuldidaktik in die richtige Richtung. Sie lässt unmittelbare, wissenschaftlich zu reflektierende Praxiserfahrungen zu, ohne einen didaktischen Filter dazwischen zu schieben und die Situationsvielfalt einer ‚didaktischen Reduktion‘ zu unterziehen. Gegenüber ‚didaktischen Reduktionen‘ ist Misstrauen angebracht – die Unsitte von ‚Arbeitsblättern‘ in Schulen, auf denen Lücken auszufüllen sind, ist noch nicht aus der Welt.
Das Boxen-Curriculum ist statischer Natur. Nichts fließt. Nichts entwickelt sich in unbekanntes Gelände hinein. Keine Expeditionen à la Jules Verne. Keine abenteuerlichen Geschehnisse hinter der nächsten Kurve, die wach halten.
Und so ist es nicht verwunderlich, dass sich die intrinsische Motivation bei nicht wenigen Studenten verflüchtigt. Sie schwänzen, schlafen ein, beschäftigen sich mit ihren Tablets und I-Phones, lassen Ghostwriter ihre Arbeiten schreiben und entwickeln sich zum worst case für ihre Dozenten.
Um dem zu entgehen, ist nicht nur die Inszenierung eines spannenden, die Boxen überwindenden Lerngeschehens angesagt, die Konfrontation der Studenten mit herausfordernden Ernstfällen, sondern auch eine veränderte Auswahlpraxis: Nur Studenten, die wirklich wollen und darauf brennen, sollten aufgenommen werden, und nicht solche, die von ihren Arbeitgebern benannt, zu ihrem Glück wie Hunde zum Jagen getragen werden sollen, oder solche, die mit zugedrücktem Auge genommen werden, weil mehr Studenten mehr Einnahmen bringen.
Die Veranstalter eines universitären Studienprogramms, das als höchst attraktiv angesehen wird, brauchen sich um studentischen Nachwuchs nicht zu sorgen.
4.2 MODERATE WEITERENTWICKLUNG
Die Fliegende Universität (Abschnitt 5) stellt eine radikalere Variante der Weiterentwicklung der Carl Benz Academy dar. Man kann zunächst aber auch moderater und pragmatischer vorgehen. Die qualitative Evaluation hat dazu einige Hinweise erbracht:
Curriculum: In regelmäßigem Turnus wird eine Programmkonferenz unter Beteiligung aller Professoren einberufen. Sie kann teils face-to-face, teils als Webinar durchgeführt werden. Ziel ist es, hochschuldidaktische Erfahrungen auszutauschen, Module inhaltlich zu vernetzen, Wiederholungen zu vermeiden, Praxisbezüge zu verstärken, sich vor einem Einbahnstraßen-Lehrstil zu verabschieden und die Module stärker an den Bedürfnissen von Studenten und Arbeitgebern zu orientieren.
Systematisches und situatives Lernen: Die Unterschiede zwischen den professoralen Auffassungen über die Art der Lehre sind erheblich. Katheder-Professoren werden von den Studenten deutlich kritisiert.
Die Studenten wollen eine lehrmethodische Vielfalt, die theoriegestützte Zugänge zur Realität ermöglicht. Hier macht es Sinn, einen Dialog zwischen den Professoren zu fördern, der diese Vielfalt des lehrmethodischen Instrumentariums und ein balanciertes Verhältnis von systematischem und situationsbezogenem Lernen anstrebt.
Theorie und Praxis: Die Wünsche der Studenten sind eindeutig: Sie wollen mehr aktuellen Praxisbezug; sie wollen, dass ihre beruflichen Vorerfahrungen und die dort identifizierbaren Schlüsselprobleme im Curriculum stärker berücksichtigt werden; sie wollen keine Fallstudien, die in Büchern nachzulesen sind; sie wollen Seminarräume links liegen lassen; sie wollen lernen, wie man komplexe Situationen wissenschaftlich fundiert aufklären und gestalten kann.
Blended Learning: Die Varianzen zwischen einer elaborierten und restringierten Nutzung von Möglichkeiten des Blended Learning sind erheblich. Es besteht bei den beteiligten Hochschullehrern Fortbildungsbedarf, um sich ein interaktionsfreudigeres Instrumentarium anzueignen. Die Kür beginnt nicht bei der Übermittlung von vorhandenem wissenschaftlichem Wissen, sondern bei der prozesshaften Begleitung von Praxisinterventionen.
Informationen über die Studenten: Die Aussagen von Professoren zeigen, dass einige von ihnen keine Informationen über die Qualifikationsprofile und beruflichen Vorerfahrungen der Studenten haben, andere nur sehr wenige. Dass ein Professor seine Studenten über Jahre begleitet, entspricht nicht der bisherigen Struktur der Carl Benz Academy. Immerhin lassen sich Informationsdefizite durch gemeinsame Veranstaltungen von Professoren und Studenten verringern. Auch wäre es naheliegend, ähnlich wie bei der Studienstiftung des deutschen Volkes durch Vertrauensdozenten die Verbindung zu den Studenten zu intensivieren.
Sprachen: Es macht keinen Sinn, chinesischen Studenten Englisch als Wissenschaftssprache aufzuzwingen, wenn sie dies nicht wollen und später - mit ihrem Autohandel irgendwo auf dem Land angesiedelt - keine wirkliche Verwendung dafür haben.
Es ist besser, den MBA auf Chinesisch und den für international tätige Manager gedachten EMBA auf Englisch anzubieten.
Akademische Standards: Die akademischen Regeln sind von den Professoren zu definieren und abzustimmen. Es können keine Verhandlungen über die Absenkung von akademischen Standards oder über Ausnahmen zugelassen werden. Andernfalls schneiden sich die beteiligten Universitäten ins eigene Fleisch.
4.3 EINE EIGENE STRUKTUR
Angeregt wird eine Dreiteilung des Studiums. Erstens: Situationsrecherchen. Zweitens: obligatorisches Studienprogramm. Drittens: ein Wahlpflichtprogramm.
Situationsrecherchen: Im Zentrum dieser Phase steht eine von Studenten und assistierenden Wissenschaftlern durchzuführende Recherche zu aktuellen generativen Themen der Arbeitgeber und zu den - meist, aber nicht nur - berufsbezogenen generativen Themen der Studenten. Es handelt sich um eine Situationsanalyse, die mehr als nur eine simple Befragung darstellt, die vielmehr die Bildung erster kleiner Situationstheorien ermöglicht und erste Annahmen über qualifikationsrelevante Sachverhalte und Qualifizierungs-Anforderungen entwicklen kann.
Dies ist das Material, das dem fortlaufenden Prozess der Curriculum-Revision dient: der realitätsbezogenen Gestaltung von Modulen der zweiten Phase (Pflichtprogramm) zum Beispiel zu realistischen Fallstudien; aber auch zur Vorbereitung von Projekten in der dritten Phase (Wahlpflichtprogramm).
Obligatorisches Studienprogramm: Es handelt sich um einige - unter Relevanz- und Gütekriterien überprüfte - Module, wie sie bisher praktiziert wurden. Teile dieser Module können in die dritte Phase übertragen und dort in Projekte integriert werden. Dieses Vorgehen ist in Universitäten erprobt worden, die ein Studium in Projekten fördern.
Wahlpflichtprogramm: Das Curriculum der dritten Phase strukturiert sich nicht nach Fächern, sondern auch nach generativen Themen. Ihre Definition stützt sich auf die Recherchen in der ersten Phase, aber auch auf andere Quellen aus Wissenschaft und Praxis. Die Studenten haben die Wahl zwischen verschiedenen Projekten, die sich den generativen Themen zuordnen lassen. Ihr gemeinsames Kennzeichen ist das einer theoriegeleiteten Intervention. Die Studenten bilden Teams, werden wissenschaftlich betreut und leisten Consulting. Projekte werden so definiert, dass sie im zeitlichen Rahmen machbar und von den Anforderungen her realisierbar sind.
Die begleitenden Wissenschaftler (es müssen nicht Professoren sein) verbleiben nicht im universitären Elfenbeinturm, sondern gehen mit ins Feld. Die Examensarbeiten werden über die Erfahrungen in den Projekten angefertigt.
4.4 AUF DEM WEG ZUR CLOUD UNIVERSITY
Hier sei ein erster Gedanke umrissen, der die Brücke der Carl Benz Academy zu einer Cloud University - in der Gestalt einer Fliegenden Universität – betrifft und die bisherige Struktur des Studiums weitreichender durchbricht:
•Das Curriculum wird nur noch nach generativen Themen strukturiert.
•Die Erarbeitung wissenschaftlicher Erkenntnisse wird durch den Fortgang von Projekten bestimmt. Wissenschaftliches Wissen wird immer dann eingeschlossen und genutzt, wenn das Projekt eine Phase erreicht, in der dieses Wissen gebraucht wird.
•Die Studenten in aller Welt bilden internationale und interdisziplinäre Teams in virtuellen Centers of Excellence, die den generativen Themen entsprechen.
•Eine internationale und interdisziplinär zusammengesetzte Task Force aus Wissenschaftlern übernimmt die Rolle der theorie- und praxisbezogenen Begleitung der studentischen Teams.
•Die Carl Benz Academy erschließt ein weltweites Netz aus Institutionen, Organisationen und Unternehmen, um Zugänge zur Praxis und zu Problemstellungen zu finden, die dieser Praxis immanent sind.
•Das Management der Carl Benz Academy hält diese Dynamik in Bewegung.
•Die Akkreditierung erfolgt bei einer internationalen Organisation, zum Beispiel bei den United Nations oder bei UNESCO.
•Die Carl Benz Academy entwickelt sich zu einer Denkfabrik mit wissenschaftlichen, kulturellen, künstlerischen und wirtschaftlichen Akzentuierungen weiter.
5. DIE FLIEGENDE UNIVERSITÄT
5.1 DIE UNIVERSITÄT WEITER DENKEN
Und nun? Nun denken wir die Universität weiter – beileibe nicht die große ganze, sondern die kleine, die wir vor Augen haben. Wir entwerfen sie als ein inspirierendes, lernintensives, herausforderndes Abenteuer. Die Fliegende Universität findet weltweit statt. Keine langweiligen Seminare mehr, keine Professoren, die vom Katheder aus dozieren und im Elfenbeinturm bleiben, raus aus dem phantasielosen Campus. Wir verabschieden uns von musealen Bildungstempeln. Unsere Studenten lernen dort, wo die Musik spielt: in Asien, Afrika, Australien und dem Pazifik, in Europa, Nord- oder Südamerika.
Die Fliegende Universität bietet, so die Idee, ein Studium der Spitzenklasse und fördert die Ausbildung und Vernetzung von Persönlichkeiten, die zu Global Leaders werden wollen. Sie lehrt ihre Teilnehmer, globale Schlüsselprobleme zu identifizieren und einen regionalen oder internationalen Beitrag zu ihrer Lösung zu leisten.
Den Studenten stehen Professoren zur Seite, die ihnen ein fundiertes wissenschaftliches und methodisches Rüstzeug verschaffen, die motivieren, assistieren und in den Projekten mitmachen.
Diese Professoren organisieren den Zugang zu herausfordernden Wirklichkeiten. Mit ihren Studenten setzen sie die schon genannte Erkenntnis von Ivan Illich um, nach der das intensivste Lernen schon genannte durch ungehinderte Teilhabe an relevanter Umgebung geschehe. Diese Aussage seines Buches „Deschooling Society“ stimmt immer noch.
Die Fliegende Universität ähnelt einer Shakespeare ´schen Theatergruppe auf Wanderschaft. Sie macht große Bogen um die von Siegfried Bernfeld aufs Korn genommenen falschen Orte pädagogischen Bemühens.
Die Fliegende Universität lädt ihre Teilnehmer ein, sich mit den Professoren an Orte des Geschehens zu begeben, über den Tellerrand zu schauen und sich zu verantwortlichen Weltbürgern zu mausern, die globales Denken mit lokalem Handeln verbinden können. Geboten wird ein Lerntypus des Entdeckens, des Abenteuers und der Intervention. Mit Paulo Freire geht es um eine enge Verzahnung von Reflexion und Aktion, um Probleme realer Natur, die gelöst werden wollen, und nicht um die Beschäftigung mit Scheinproblemen in pädagogischen Einrichtungen. Humboldt nennt das die Anverwandlung von Welt. Sie wird nicht hingenommen, sondern gestaltet. Die Fliegende Universität lehrt, wie man wichtige Situationen gestalten kann. Sie organisiert dazu sowohl wissenschaftliches Wissen wie auch Erfahrungswissen. Sie ist geprägt durch Unternehmensgeist und durch die Förderung des innovativen Entrepreneurship.
5.2 DIE TEAMS
Diesmal wird es kein Programm für grundständige Studenten, sondern eins für Manager und Unternehmer sein, die ihre Karriere gemacht und noch kein Burnout erlebt haben, die aber dort angekommen sind, wo sich ein Scheideweg eröffnet: Entweder das Leben geht so weiter und wird zur Routine ohne Inspiration, oder es gelingt ein Absprung. Wohin?
Ins Grüne, in die alternative Landkommune? In die Eröffnung einer Beratungspraxis à la Ex-Manager verhilft zu spiritueller Erleuchtung? Doch wohl nicht.
Die Fliegende Universität bietet ein Sabbatical, das zwei, drei Jahre dauern mag und ein bißchen etwas von der Meuterei auf der Bounty hat: Der böse Kapitän Bligh (hier: das alte Leben) wird ins Boot gesetzt und fortgeschickt. Die an Deck bleibende Mannschaft, voran der von Bligh gebeutelte Erste Offizier, Fletcher Christian (hier: die Teilnehmer der Fliegenden Universität), erreicht - mit Zwischenstation Tahiti - das hoffentlich gelobte Land, die auf den britischen Admiralitätskarten falsch eingezeichnete Insel Pitcairn (hier: ein Ort des Geschehens der Fliegenden Universität).
Nun wissen wir aus der Geschichte der Bounty, dass es der Mannschaft ziemlich misslungen ist, auf Pitcairn das gelobte Land anzuverwandeln. Aber genau das wäre das Ziel der Fliegenden Universität: Situationen zum Besseren wenden.
Läge Pitcairn nicht so abseits, wäre die Insel auch heute noch ein Ort des Geschehens, an dem nichts zum Besten steht, an dem ein Team der Fliegenden Universität jedoch studieren könnte, was schief gelaufen ist und immer noch schief läuft, und es könnte ja sein, dass die Nachfahren der Meuterer und ihrer tahitischen Frauen ganz dankbar wären, wenn sie Unterstützung bei der Lösung einiger sozialer, kultureller und juristischer Probleme erhielten.
Die Fliegende Universität bildet Teams, die sich über die Kontinente verteilen und dort forschen und handeln. Über die sieben Berge und Meere hinweg verständigen sie sich im Netz. Die Professoren sind Mitglieder der Teams, sie sitzen nicht in Boxen und lassen nicht die Teilnehmer zu sich kommen, sie verschicken übers Netz auch keine Hausaufgaben, sie wissen nicht alles besser, sie forschen und handeln vielmehr in den Teams, dort, wo die Orte des Geschehens sind und nicht dort, wo sie als Professoren ihren Sitz haben. Das schweißt zusammen. Und es wird sich zeigen, dass keiner der Beteiligten Lösungen aus dem Hut zaubern kann, sondern die Teams an Analysen und Lösungen arbeiten, dass sie erfolgreich sind oder auch - hoffentlich auf hohem Niveau - scheitern.
Ein Unterschied zwischen ihnen und den Meuterern von der Bounty besteht ja darin, dass sie bei der Anverwandlung von Welt auf wissenschaftliche Erkenntnisse und Verfahren zurückgreifen können, und das die Teams mit ihren Professoren ‚on demand‘ lernen, wie das geht. Aber Vorsicht: Man glaube doch nicht, dass sich wissenschaftliche Theorien einfach wie Äpfel vom Baum pflücken lassen. Wir - in der herkömmlichen Universität - haben oft erlebt, dass einige der von anderen ausformulierten Theorien irgendwie nicht passten, irgendwie nicht weiterhalfen, oft jedenfalls nicht mehr als die eigene, durch eine Situationsanalyse gestützte bruchhafte Erfahrung und Erkenntnis. Dann stellt sich die Frage nach des Kaisers neuen Kleidern. Oder die nach der Komplexität von Situationen, die sich empirisch nicht recht abbilden oder gar interpretieren lassen.
5.3 WOHIN DES WEGES?
Die Kunst der Curriculumentwicklung der Fliegenden Universität besteht nun keinesfalls darin, Module zu formen und sie mit Inhalten zu füllen, sondern darin, spannende Orte des Geschehens und die dort existierenden generativen Themen ausfindig zu machen. Dies ist ein Verlauf, an dem die Teams bereits beteiligt werden. Sie sollen keine gemachten Betten vorfinden.
Die Orte sollten geradezu bersten vor Herausforderungen und jede Menge Gestaltungschancen enthalten. Die Teams bestehen nicht aus Anfängern, und sie zu unterfordern hieße, die Fliegende Universität als fluglahme Ente zu konzipieren. Um sich nicht in der Vielfalt von Möglichkeiten zu verlieren, wird eine Situationsanalyse die Identifizierung von generativen Themen erleichtern und damit zur Frage führen, welche von ihnen Anlass für die Durchführung von Projekten sein können. Denn eine Auswahl aus der Vielfalt ist notwendig. Ein Auswahlkriterium könnte sein: geeignet, auf lokaler Ebene zu lernen, wie „global leadership“ beschaffen sein müsste. Ein zweites: geeignet, intelligente Verbesserungen für Menschen zu schaffen, die unter miserablen Verhältnissen leiden. Ein drittes: geignet, keine Langeweile aufkommen zu lassen, vielmehr eine präskriptiv nicht erfassbare Kette zu bilden aus abenteuerlichen Überraschungen, Zufällen, queren Umständen, Lichtblicken, Anspannungen, Inseln der Glückseligkeit und Erlebnissen von der Art: „Wow, jetzt haben wir die Lösung, allerdings eine andere, als wir dachten!“
5.4 NUN ABER: DIE WISSENSCHAFT!
Klar, es könnte sein, dass die Teilnehmer der Fliegenden Universität im Rausch des Abenteuers beschließen, auf Wissenschaft zu verzichten, aber das sollte und muss nicht sein, weil es gelingen kann, die Wissenschaft selbst als Abenteuer zu erschließen. Im Grunde stehen hier die Antipoden „systematisches“ und „situatives“ Lernen gegenüber, die man nicht in Schubladen stecken muss (von denen entweder die eine oder andere geöffnet wird), sondern in Interaktion bringen kann.
Eine nicaraguanische Lehrerin hat zu Zeiten, als die sandinistische Revolution noch jung und hoffnungsvoll war, einmal folgendes Bild entwickelt: Sie stelle sich das Wissen dieser Welt in einem Berg versammelt vor. Der hätte ein Tor, an das sie klopfen könne. Wenn sie nun mit ihren Kindern dabei sei, im Rahmen der Gesundheitskampagne die Ausbreitung des Dengue-Fiebers praktisch zu bekämpfen, würden sie und ihre Kinder immer dann an das Tor klopfen und es öffnen, wenn sie im Verlauf ihrer Bemühungen dieses oder jenes Wissen benötigten. Und sie würden das Tor schnell wieder zumachen, wenn sie das Wissen entnommen hätten. Genauso ist es. Wissenschaftliches Wissen und wissenschaftliche Verfahren werden dann erschlossen, wenn sie im Prozess des Projektes gebraucht werden. Geht man so vor, wird man merken, dass die Grenzen zwischen den Wissenschaftsdisziplinen löchrig wie ein Schweizer Käse werden, und das Interdisziplinarität eher zum Normalfall wird.
Die zahmere Variante besteht darin, den Erwerb systematischen Wissens in einem Pflichtteil und die projektbezogene Nutzung dieses Wissens in einem Kürteil anzubieten. Kann man machen, ist aber weniger spannend. Oder – wie zu Gründungszeiten der Universität Bremen: man kombiniert ein Studium in Projekten mit „Stützkursen“ zu Beispiel zu qualitativen Methoden. So geschah es übrigens auch im Curriculum „Soziales Lernen“ der Arbeitsgruppe Vorschulerziehung in den 1970er Jahren: Den Kindern die Angst vor einem Aufenthalt im Krankenhaus nehmen? Mit ihnen Recherchen zum Überleben im Kinderkrankenzimmer durchführen? Ja, aber irgendwann kann die Frage auftauchen, wie denn Blut beschaffen sei, und warum es aus dem Körper nicht auslaufe, wenn man sich mal geschnitten habe. Die hoffentlich phantasie- und aktionsreiche Antwort der Erzieherin auf diese Frage wird im Curriculum „Soziales Lernen“ eine „Didaktische Schleife“ genannt, und damit ist ja auch gemeint, dass die Schleife dort wieder ankommt, wo das Projekt weitergeht.
5.5 ORTE DES GESCHEHENS
Die Fliegende Universität macht sich also auf den Weg. Ihre Teams arbeiten an den Orten des Geschehens eng mit den Menschen zusammen, die das hoffentlich für gut befinden, weil die Intelligenz kleiner Schwärme aus Einheimischen und Fremden ergebnisreicher sein kann, als der Versuch, Probleme auf alte Weise durch Nabelschau und Verwaltungshandeln zu lösen.
Wohin des Weges? Nach Salvador Bahia zum Beispiel. Herausfinden, was den kulturellen Aufstieg der Stadt in den 1980er Jahren bewirkt hat. War es die afro-brasilianische Bewegung mit Olodum, schwarzen Karnevalsblöcken, Candomblé, ohrenbetäubenden Percussionsgruppen, war es die Restaurierung der Altstadt, die um Initiativen nicht verlegenen Stadtregierung? Und warum sieht es so aus, als würden diese Chancen wieder verspielt? Wie kann „good city governance“ entstehen und vor allem dauern? Das generative Thema könnte sein: „die Halbwertzeit kultureller Amalgame“. Denn ein soziales, kulturelles und ökonomisches Amalgam aus afrikanischen, indianischen und europäischen Anteilen hat Salvador Bahia zu neuer Blüte verholfen. In der Tradition der Quilombos, der Widerstandszentren entlaufener Sklaven, im Kampf gegen den Rassismus mehr als 100 Jahre nach der Sklavenbefreiung hat Salvador Bahia zur Aufmischung der Weltmusik beigetragen, hat dem kommerzialisierten Karneval in Rio die Karnevalsblöcke des Movimento Negro entgegengesetzt und den Samba durch Salsa und Lambada verschärft. Und nun? Langt die Korruption wie eine Krake zu? Was erodiert? Und was lässt sich dagegen tun? Einen Masterplan entwickeln, der die Halbwertzeit des Amalgams auf eine weitere Zukunft hin verlängert?
Oder nach Bali. Das generative Thema „Ausverkauf? Kulturelle Resilienz und ökonomische Versuchung“ liegt hier nahe. Die Entwicklungen auf der Insel sind paradox. Einerseits wird die unvergleichliche Kultur der Balinesen durch den Tourismus gestärkt: der finanziellen Einnahmen wegen, die es den Balinesen mehr als früher erlauben, ihre religiös begründeten, aufwendigen Zeremonien und Feste zu feiern.
Auf der anderen Seite erliegen viele von ihnen der Versuchung, ihr Land im großen Stil an Ausländer zu verkaufen, und so entstehen jede Menge Hotels, Geschäfte und Residenzen, und eine Community von mehrheitlich amerikanischen Expatriates ist dabei, die Insel in die Hand zu bekommen. Der von diesen Expats selbst gern in Anspruch genommene Bezug zur balinesischen Kultur ist nur mehr folkloristischer Art. Während in Ubud noch kulturelle Resilienz beobachten ist, stellt Kuta das Ballerman-Beispiel Balis dar, ein verlorenes Paradies, in dem seinerzeit die Bomben der Fundamentalisten explodierten. Ein Team der Fliegenden Universität fände hier jede Menge Ansatzpunkte für Aktionsforschung, die zur Bewußtwerdung des Debakels beitragen könnte.
Oder nach Thailand: Dort gibt es die School for Life im königlichen Forst in den Bergen nordöstlich von Chiang Mai. Im Jahr 2003 wurde sie für Aids-Waisen gegründet, heute fördert sie Kinder diskriminierter ethnischer Minderheiten, der Akha, Lisu, Lahu, Hmong, Karen und Thaiyai. Ihr Leitsatz: „The best for the poorest“. Ihr Konzept wurde von UNESCO als "much needed world class innovative effort in the field of education" und als "new standard of educational excellence for the world community of the 21st century" gewürdigt. Die School for Life befindet sich in der entscheidenden Phase, von Spenden, von denen sie bisher getragen wurde, unabhängig zu werden. Zwei Wege werden dabei eingeschlagen: „Self-sufficiency Economy“, ein Konzept, das Thailands König vor allem seit der Finanzkrise 1997 fördert, und „Social Entrepreneurship“ im Sinne von Muhammad Yunus, dem Gründer der Grameen Bank in Bangladesh, der anläßlich der Verleihung des Friedensnobelpreises in Oslo 2006 darüber gesprochen hat. Das ist ja nicht so einfach: Lehrer, die eigentlich nur Lehrer sind, in soziale Unternehmer zu verwandeln, oder sozial-unternehmerische Ideen zu entwickeln, deren Umsetzung die Erwirtschaftung von erheblichen Gewinnen zu gemeinnützigen Zwecken ermöglicht. Und „Self-sufficiency Economy“? In der Nähe von Ubon Ratchathanee lebt Asoke, eine Gemeinschaft intellektueller Buddhisten, die ein Modell entwickelt haben, wie man sich bei hoher Lebensqualität durch eine ausgeklügelte organische Landwirtschaft aus dem Geldkreislauf ausklinken kann. Soweit will die School for Life keinesfalls gehen, gleichwohl ist wissenschaftliches Wissen notwendig, um die Kosten herunterzudrücken und die Erträge aus organischer Landwirtschaft und artgerechter, chemiefreier Tierhaltung zu steigern.
Die School for Life würde jedes Team der Fliegenden Universität willkommen heißen, das als Business Coach, als Erschließer von funktionalem wissenschaftlichem Wissen und wissenschaftsgestützten Verfahren das Projekt auf seinen beiden Wegen begleitet.
Die Orte des Geschehens können wechseln. Dann wird vielleicht Bali durch Griechenland abgelöst, Brasilien durch Nigeria oder Thailand durch die USA. Es ist an den vorbereitenden Teams, auf der Weltkarte die Orte des Geschehens zu markieren.
6. FLUCHT AUS ALCATRAZ ODER ZURÜCK IN DEN MAHLSTROM?
Natürlich muss man die Fliegende Universität planen: ihre Struktur, Treffen, Seminare, Workshops, Think Tanks, das Blended Learning, die Forschungstagebücher, die Projekte, die Berichte, Essays, Abschlussarbeiten. Und es gilt, die Professoren weltweit zu suchen und zu finden, die sich auf dieses Abenteuer einlassen und dabei der eigenen déformation professionelle entkommen wollen. Insofern kann auch eine sorgfältig geplante Fliegende Universität einer gelungenen Flucht aus Alcatraz ähneln, dem Exodus aus jener Form von Universität, die ihren Staub nicht loswerden will und deren Strukturen und Reglementierungen ausbruchwillige Studenten und Professoren fesseln.
Wenn man aber entkommen ist, sollte man aufpassen, nicht wieder eingeholt zu werden. Denn das Gefühl, vom Ballast frei zu sein, kann sich als Illusion erweisen. Nicht frei, sondern am äußersten Rand des Mahlstroms: Der aber zieht zurück in den Schlund, und schon sind wir wieder in Sichtweite der Wrackteile, die in Edgar Allan Poes Geschichte im Mahlstrom kreisen: in unserem Falle die Multiple-Choice-Tests, Papierverschiebe-Seminare, Frontalveranstaltungen, Anwesenheitslisten, Scheine, Studienordnungen, Prüfungsordnungen, Hausaufgaben per E-learning, Mittelverwaltungen im Schneckentempo, Gremien, Sitzungen, Fraktionen, Verteilungskämpfe – und was da sonst noch alles herumschwimmt.
Ich stelle mir eine Absolventin der Fliegenden Universität vor, die sagt: „Ich habe gar keine Universität gesehen. Unsere Professoren haben oft nicht gewusst, wo genau es lang geht. Aber ich habe noch nie so viel gelernt.“