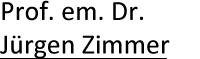Am Tag zuvor hat Kru Tomsri ihre Freunde geschickt. Sie, die viele Jahre zum
umgezogen. Seitdem hat sie Heimweh nach der School for Life. Aber ihre
Liedern und Tänzen. Und sie haben Geschenke mitgebracht. Es ist ein Tag
großen Vergnügens.
Am 24. Dezember kommen die Freunde von Kru Nui, auch er ein ehemaliger
Lehrer, der mit Projekten rings um den von ihm betreuten Gästebereich Kinder
in einem Restaurant Management Team vereinte. Musiker sind dabei, und bis in
den frühen Abend hinein tanzen die Kinder. Dann wird es still. Walter
Thiermann und seine Frau Mem, die die School for Life fast von Anfang an
unterstützen und begleiten, haben den Weihnachtsbaum gestiftet und
geschmückt. Die Kinder, ob nun Buddhisten oder Christen oder beides, kennen
die Weihnachtsgeschichte, und deshalb erzähle ich ihnen diesmal von der
Bergpredigt. Ich bitte ein Mädchen zu mir, nehme ihre Hand und simuliere eine
Ohrfeige auf meine linke Backe, halte danach die andere Backe hin und erkläre,
welche Botschaft damit gemeint sein könnte. Später beobachte ich zwei Jungen,
die die Szene nachspielen und darüber diskutieren.
In der Aula ist ein Buffet aufgebaut. Als Getränke gibt es Tamarinensaft, der
vom Abt und den Mönchen des Tempels von Lampun selbst hergestellt wurde.
Mittags kam er mit einem Wagen vorbei und brachte die großen Behälter. Ein
buddhistischer Abt, der am christlichen 24. Dezember zur School for Life
kommt, um ein Geschenk zu überreichen? So ist es. Und wäre es überall auf der
Welt so, hätte die Botschaft der Bergpredigt Chancen, das Paradies auf Erden
einzuläuten.
Im Nationalpark, 31. Dezember 2012
Die Kinder der beiden Schools for Life sind die Ferien gefahren. Es ist gegen 21
Uhr in einem kleinen Nationalpark an der Küste irgendwo zwischen Phuket und
Takua Pa. Die Park Rangers haben eingeladen. Am Strand, unter Bäumen nahe
am Wasser, lagern 1000 Thais in großen Familiengruppen. Die Feuer flackern,
und der Duft von vielen Grills weht herüber zum Unterstand der Rangers. Die
wirken wie ein verlorener Haufen, die feiern wollen, aber nicht dürfen. Ein
bisschen aber schon, in Schichten. Denn während die einen auf Streife gehen
und aufpassen, dass keine Raketen in die knochentrockenen Bäume geschossen
werden, singen die anderen ihre Lieder. Eine Karaoke-Anlage ist aufgebaut, der
Text läuft über den Bildschirm. Die Männer und ihre Frauen, die mitgekommen
sind, singen vor allem über die thailändischen Grundbefindlichkeiten „falling in
love“ und „broken heart“. Am Rande des Unterstandes wird fettes
Schweinefleisch in kurze, schmale Streifen geschnitten, mariniert und gegrillt.
Nach etwa einer Stunde kommen die anderen Rangers von der Streife zurück
und übernehmen das Mikrophon und den Grill, während die bisherigen Sänger
ihren Pflichten nachgehen. Hin und wieder ist ein Lied dabei, das nur aus dem
Isan, dem Armenhaus Thailands, stammen kann. Es ist Dingdongmusik und sie
gefällt mir sehr: ein fast jazzmäßiger Rhythmus, eine Sängerin mit frechen
Texten, in denen zum Beispiel thailändische Männer durch den Kakao gezogen
werden, Einschläge von Rap mit improvisierten Texten, und wenn man das alles
auf der Bühne sieht, befinden sich hinter der Sängerin viele Mädchen, die einen
angedeuteten Cancan tanzen, so, als kämen sie mit dem Beineschwenken nicht
über die Kniehöhe hinaus.
Während ich aus Mangel an Alternativen und bedrängt von der Gastfreundschaft
der Parkbewacher möglichst lange an einem Schweinestreifen kaue und die pure
Fetthälfte irgendwie verschwinden lasse, kommen einige Polizisten und
berichten, weit draußen befinde sich ein Schiff, wahrscheinlich mit Flüchtlingen,
und man werde im Morgengrauen ein Boot dorthin schicken.
Draußen, fast hinter dem Horizont, blinzeln die Lampen der Fischerboote, die
auf nächtlichen Fang aus sind.
Es ist kurz vor Mitternacht. Kein Karaoke mehr. Die Rangers verteilen sich. Ich
mache mich auf den Heimweg ins neue Jahr. Um Mitternacht ist fernes
Feuerwerk zu hören. Nach fünf Minuten ist Stille. Die Thais sind gewitzt genug,
nicht Unsummen in die Luft zu ballern.
Zwei Tage später schaue ich mir den Park noch einmal an: Er ist blitzblank.
Gute Geister haben alle Überreste beiseite geschafft.
Beim großen Buddha von Phuket, 1. Januar 2013
Am Rande der Stadt Phuket auf der gleichnamigen Insel, hoch oben auf einem
Berg, ist Thailands größte Buddha-Statue errichtet worden. Nicht ganz so hoch
wie der Christus von Rio, aber ungleich beleibter und mit einem sanften Lächeln
ausgestattet. Die Unmengen von Zement, die dort verbaut wurden, sind hinter
alabasterähnlichen Kacheln versteckt, die alle Rundungen, Rinnen und Falten
mitvollziehen. Ein steter Pilgerstrom bewegt sich auf dem Berg. Der Eintritt ist
frei, aber man kommt nicht zum Buddha, ohne die große Halle zu passieren, in
der Mönche ihre Gesänge anstimmen und Gläubige mit Wassertropfen
besprengen, und in der zahlreiche Schilder darauf hinweisen, doch bitte für die
Vollendung des Bauwerks zu spenden.
Ich treffe auf Sukorn, einen der Initiatoren des Buddha-Monuments, und will ihn
eigentlich fragen, was diese schiere Größe mit dem Buddhismus zu tun habe,
und ob Buddha diesen Gigantismus angemessen gefunden hätte, aber weil ich
mir seine Antwort fast selbst geben kann, und mit Blick auf die Massen von
Pilgern schon höre, was er sagen würde, stelle ich diese Fragen nicht.
Sukorn ist für das Glück der Pilger zuständig. Er lehrt Meditation. Wir sprechen
aber nicht über den inneren, sondern über den Religionsfrieden, den die Kinder
der School for Life täglich praktizieren. Er setzt sich für eine alle Religionen
umfassende Ökumene ein. Die zentralen Botschaften der Religionen seien
gleich: Frieden auf Erden und ein menschenwürdiges Leben für alle. Reichtum
mache nicht glücklich.
Sukorn erinnert an den Tsunami, hat von der School for Life in Phang Nga
gehört und bietet eine Zusammenarbeit an. Auf dem Gelände der Schule steht
der Pavillon der Religionen. Wir hatten ihn 2005 gebaut, um in der Region mit
Buddhisten und Moslems ein Zeichen zu setzen. Jeder Raum ist einer
Weltreligion gewidmet: dem Buddhismus, dem Christentum, dem Islam und
dem von Hans Küng begründeten Projekt „Weltethos“. Die Idee, zu Gesprächen
zwischen den Religionsvertretern, Kindern und Lehrern einzuladen, könnte
vielleicht mit dem Initiator des großen Buddha von Phuket verwirklicht werden.
Auf dem serpentinenreichen Weg abwärts hält der Fahrer des Wagens neben
einem alten Mann, der im Straßengraben mit Schaufel und Hacke den Weg für
den Abfluss des Regenwassers frei macht. Dies, sagt der Fahrer, sei der Besitzer
des Landes, auf dem der Buddha steht: ein großes Stück Land und ein alter
Mann, der es umsonst abgegeben hat und seine Arbeit erledigt, als sei er ein
Tagelöhner wie eh und je.
School for Life, 9 Januar 2013
„In Panama“ – so die Antwort auf meine Frage, wo Dominique Leutwiler,
Schweizerin und General Manager der School for Life, geboren wurde. Und
wann? Am 24. April 1965. Warum kommt eine Schweizerin in Panama zur
Welt? „Mein Vater war Manager bei Nestlé und mit dem Aufbau oder der
Sanierung von Fabriken in verschiedenen Ländern befasst.“ Er war auf die
Herstellung von Dosen spezialisiert. Später kamen – jenseits von Nestlé – Steine
und Kugeln dazu. Er hatte eine Maschine konstruiert, die Steine kugelrund
machen konnte. Die eigneten sich für Kugelbrunnen mit großen oder kleinen
Kugeln, die sich, vom Wasser angetrieben, fortwährend drehen.
Panama! Das ist die Erinnerung an eine der frühen Fahrten der High Seas High
School durch den Kanal auf dem Weg zu den Galapagos Inseln. Oder an den
Nicaragua-See, ein vom Pazifik abgeschnittenes Binnenmeer, in dem Haifische
sich ans Süßwasser gewöhnt haben, und an die Pläne, einen zweiten Kanal
zwischen Atlantik und Pazifik zu bauen und den See einzubeziehen.
Panama dauerte für Dominique nur zwei Jahre, dann ging es für vier Jahre nach
Spanien mit dem Besuch einer spanischen Grundschule und von dort vier
weitere Jahre an die Elfenbeinküste. In der Dorfschule unterrichteten Nonnen
auf Französisch. Die nächste Station hieß Fribourg, und Deutsch war die
Unterrichtssprache. In Griechenland, der nächsten Station, hatte die Familie ein
Fischerboot, auf dem man schlafen konnte. Dominique wurde zur Wassernixe.
Beim griechischen Militär lernte sie das Reiten. Als Zwölfjährige nahm sie an
Wettkämpfen im Springreiten teil und musste ihren Vornahmen ändern, damit
sie auf den Listen als Junge durchging. Sie besuchte ein deutsches Gymnasium
und lernte die deutsche und neugriechische Sprache. Von dort ging es nach
Thailand in eine schweizerische Schule, die ihr nicht gefiel. Sie war 15 Jahre alt
und fand Schulen langweilig. Im schweizerischen Städtchen Chur absolvierte sie
eine Ausbildung zur Hotelfachfrau und arbeitete anschließend in Hotels in
Montreux, Zürich und in den Schweizer Alpen.
Inzwischen hatte Dominique ihren Mann kennengelernt, und ab ging‘s nach
Florida, um von dort aus den amerikanischen Markt für Kugelbrunnen zu
erschließen. In den sechs folgenden Jahren wurden vier Kinder geboren. Eines
Tages verschwand ihr Mann und überließ die Fünf ihrem Schicksal. Mit drei
Koffern und 2.000 Dollar in der Tasche kam Dominique mit ihren Kindern in
Thailand an und übernahm die Fabrik ihres Vaters, in der die Kugelbrunnen
gebaut wurden. Eine Weile ging das gut, die Kugelbrunnen waren perfekt in
ihrer Rundung, sie rollten über dem Wasser und blieben nie hängen. Aber dann
kamen Chinesen, fotografierten und imitierten die Kugelbrunnen und besetzten
mit schlechterer Qualität und billigeren Preisen den Markt. Dominique und ihr
Vater übergaben die Fabrik den Angestellten. Dominique kam zur School for
Life.
Heute, am 9. Januar 2013 sind ihre Kinder groß geworden; Vincent ist 24, Alex
17, und die Zwillinge Dennis und Daisy sind 15 Jahre alt. Ihre Lehrer in den
USA unterrichten über E-Learning, und die Zeit, um sich mit ihnen direkt
auszutauschen, liegt zwischen vier und fünf Uhr nachts. Zu Hause sprechen sie
Schweizerdeutsch und Englisch. Die Kinder waren nie in Europa, und Ferien zu
fünft gibt es nicht.
Ein bewegtes, oft hartes, immer herausforderndes Leben. Ihre Erfahrungen
helfen Dominique, die School for Life auch dann auf Kurs zu halten, wenn es
stürmisch wird.
Wasserburg am Bodensee, 17. Februar 2013
Das Haus auf der Pfannhalde ist umgeben von Obstplantagen, Wiesen und
Gemüsefeldern. Zum Süden hin glitzert der See. Heute liegt Schnee. Am
Futterhäuschen herrscht Hochbetrieb. Ein Rabe hockt vor der gläsernen
Verandatür und wartet auf kleine Käsestückchen. Die ersten schluckt er. Die
anderen packt er mit dem Schnabel und versteckt sie. Unter der Hecke legt er sie
ab und baut aus alten Blättern kleine Hügel als Abdeckung. Die Sonne steigt
über den Bergen Vorarlbergs auf.
An diesem Vormittag kommt eine Kandidatin aus Radolfzell, die in der School
for Life Volontärin werden will. Sie will im Juni Abitur machen und zeitgleich
an den deutschen Rudermeisterschaften teilnehmen. Eine doppelte
Herausforderung, die mir imponiert, und eine gute Voraussetzung dafür, aus dem
Volontariat etwas zu machen.
Florian Aicher, Architekt aus Rotis im Allgäu, hat vor zehn Jahren auf dem
Gelände der School for Life eines der ersten Gebäude entworfen und seien Bau
beaufsichtigt. Er ist bis heute der stabilste Bau. Florian ist einer der Söhne von
Otl Aicher, dem Mitbegründer der Ulmer Hochschule für Gestaltung und
Designer der Olympischen Spiele in München 1972, und von Inge Aicher-
Scholl, der überlebenden Schwester der Geschwister Scholl. Über sie sind
zeitgleich zwei Biographien erschienen. In Lindau frage ich im kleinen
Buchladen „Papillon“ nach den beiden Büchern. Die Buchhändlerin kennt die
Aichers. Und so existiert zwischen Konstanz, Überlingen, Salem, Isny, Rotis
oder Lindau ein kritisches soziales Netz, das den Ausspruch Hellmut Beckers,
damals Rechtsanwalt in Kreßbronn, diese Gegend sei zu schön, um
nachzudenken, irgendwie widerlegt.
Lindau im Bodensee, 20. Februar 2013
Hermann Dorfmüller, mein Freund seit Schulzeiten, langjähriger Stadtrat in
Lindau, zusammen mit Jean Ziegler und anderen Trägern des „Sozialistenhutes“,
geehrt mit dem Bundesverdienstkreuz, gehört zu den langjährigen Förderern der
School for Life. Er setzt sich auch öffentlich in der „Lindauer Zeitung“ dafür
ein. Im Hauptberuf war er Lehrer an der Hauptschule in Lindau-Reutin, einer,
den seine Schülerinnen und Schüler auch nach Jahrzehnten noch verehren. Ich
war, mit 15 Jahren aus der Hermann Lietz-Schule (Bieberstein/ Rhön) an die
Oberrealschule mit Gymnasium auf der Lindauer Insel versetzt, der Meinung,
nun sei nach der Zeit der Strenge im Landerziehungsheim die Freiheit
angebrochen.
Hermann, Walter (später Oberst bei der Bundeswehr), Ulrich (später ein Richter)
und ich gründeten den „Roten Faden“, der – Mitte der 1950er Jahre – nichts mit
Politik, sondern damit zu tun hatte, dass wir zum Tanzstunden-Abschlussball
statt mit einer Krawatte mit einer roten Kordel um den Hals erschienen. Hätte
die Schulleitung uns allerdings bei unserem immer noch geheimen
Meisterstreich erwischt, wären wir hochkant herausgeflogen. Aber sie erwischte
uns nicht, und so ging alles seinen biographischen Gang. Seitdem habe ich ein
großes Verständnis für Schulstreiche, und Kinder der School for Life, die mal
über die Stränge schlagen, finden in mir keinen Ankläger.
Lindau im Bodensee, 22. Februar 2013
Was mir aus dem Physikunterricht des Lehrers Flessa an der Lindauer
Oberrealschule mit Gymnasium geblieben ist? Die Empfehlung, von der
Fußgängerbrücke, die nahe beim Hauptbahnhof über die Gleise führt, nicht auf
die elektrischen Oberleitungen zu pinkeln. Das fand ich unmittelbar
einleuchtend.
Über dem Eingang des Lindauer Stadttheaters (damals war die Schule direkt
daneben untergebracht) steht der Satz „NON SCHOLAE SED VITAE
DISCIMUS“ (nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir). Viele
Jahre später sehe ich in Manila einen Studenten mit einem T-Shirt und der
Aufschrift „Less CURRICULUM more VITAE“. Hört, hört! Eine Weile später
trugen die Kinder der School for Life diesen Spruch auch auf ihren T-Shirts.
Khao Lak, 19. März 2013
In Khao Lak, nicht weit von der Hanseatic School for Life, sprach mich im
Januar die Managerin eines Hotels an, eine gebildete, warmherzige Frau, ob ich
ihr ein par deutsche Sätze aufschreiben könne. Sie wolle ihren neuen deutschen
Freund aus Erfurt – nennen wir ihn Rudi –, der des Englischen nicht sonderlich
mächtig sei, per SMS mit diesen Sätzen überraschen. Ich weiß nicht mehr
genau, was ich ihr aufgeschrieben habe, aber es waren Abstufungen von „wie
geht es dir“ über „ich vermisse dich“ bis „ich liebe dich“. Sie sagte damals, sie
wolle die Sätze verwenden, je nachdem, wie sich die Geschichte
weiterentwickle.
Später kam eine kurze Nachricht von ihr, alles sei bestens, er würde sie auch
lieben. Mich erinnerte diese Geschichte an ein Treffen mit koreanischen
Deutschlehrern in Seoul, die darüber klagten, dass ihre Schüler kein Interesse
am Deutschunterricht hätten. Als ich mit den Schülern sprach und sie fragte, was
sie interessieren könnte, antworteten sie: „Liebesbriefe schreiben und eine
deutsche Freundin haben.“
Omondi aus Kenia, vor Zeiten Au-pair in meiner Familie, schickte mir Jahre
später aus Nairobi eine Jugendzeitschrift, in der die letzten Seiten mit Anzeigen
von Teenagern gefüllt waren, die alle einen Freund in Europa oder den USA
suchten. Die Zeitschrift lebte davon, auch wenn es klar war, dass keine der
Anzeigen je einen Leser in weiter Ferne finden würde.
Vor einer Woche rief mich die Managerin an und fragte mich, ob ich ihr helfen
könne, ein Visum für Deutschland zu bekommen. Sie sei sich aber nicht ganz
sicher, ob Rudi das auch wolle. Ich formulierte für sie eine freundliche Anfrage,
ob ihr Kommen erwünscht sei. Keine Antwort. Sie schickte eine zweite Anfrage.
Keine Antwort. Es könnte sein, dass eine Thai aus gutem Hause auf einen
deutschen Hasenfuß hereingefallen ist.
Berlin, 26. April 2013
Der Vorstand der Shaul und Hilde Robinsohn Stiftung tagt. Dr. Hans Henning
Pistor ist zum letzten Mal dabei. Er war ein treuer, kompetenter Begleiter der
Arbeit der Stiftung und voller Sympathie für die School for Life. Er, 1924 in
Cuxhaven als Sohn eines Försters geboren, verabschiedet sich jetzt in den
Ruhestand. Wir kennen uns seit den 1970er Jahren, seit seiner Zeit beim
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und meiner beim Deutschen
Jugendinstitut. Hans Henning Pistor war zuvor Lehrer, Erzieher und
stellvertretender Schulleiter am Birklehof (Hinterzarten). Beim Stifterverband
wurde er Referent für Bildungsprogramme und schließlich stellvertretender
Generalsekretär in der Stiftungsverwaltung, die im Laufe der Jahre stark
expandierte. Mit seiner Frau Ingeborg hat er vier eigene und zwei Pflegekinder
großgezogen. Er kannte Dr. Hilde Robinsohn gut und zögerte nicht, in der von
ihr gegründeten Stiftung mehr als 15 Jahre mitzuwirken. Ein ganz großes
Dankeschön, lieber Hans-Henning!
Berlin / Bali, 4. Mai 2013
Im Tagebuch vom 8. August 2012 hatte ich geschrieben, dass Chanmongkol und
Suchart in der School for Life auf die Idee gekommen waren, große Tokay
Geckos zu züchten und sie bis zu einem Gewicht von 400 Gramm und einer
Länge von 40 Zentimetern wachsen zu lassen. Sie sollten dann in anderen
Ländern zu traditionell-medizinischen Zwecken genutzt werden. Zwei Geckos
wuchsen unter der Obhut der beiden auf, wurden mit Insekten gefüttert und
pflegten den Müßiggang. Da ich wusste, dass gefangene Geckos bei Farmern
normalerweise im Kochtopf landen, und nachdem ich erfahren hatte, dass Tokay
Geckos keinem Schutz und auch keiner Exportbeschränkung unterliegen, hatte
ich nichts dagegen.
Aber ich lag ganz falsch. Carol Kenwrick, Mitglied des Begawan Foundation
auf Bali (
www.begawanfoundation.org) , die das Tagebuch gelesen hatte,
schickte mir einen Bericht von „WWF.TRAFFIC“, der von einer die Tokay
Geckos betreffenden Gruselgeschichte handelt: Während früher Substanzen der
Geckos im Rahmen von traditioneller asiatischer Medizin eingesetzt und seit
Jahrhunderten gehandelt wurden, nahm dieser Handel ab 2009 einen riesigen
Aufschwung, weil nicht nur in Asien das Gerücht entstand, eine aus Substanzen
von Tokay Geckos gewonnene Medizin können HIV/AIDS heilen.
Die Palette vermeintlicher Heilkräfte der Gecko-Medizin war auch vorher schon
umfänglich. Sie sollte gegen Hautkrankheiten, Asthma, Diabetes, Krebs,
Erektionsschwäche und Dauerhusten helfen und wird als Pulver, in Fläschchen,
als Pillen oder in Wein verabreicht. Taiwan hat seit 2004 15 Millionen Geckos
importiert, davon kamen 71% aus Thailand, und zwischen 1998 und 2004 8,5
Tonnen getrockneter Tokay Geckos in die USA exportiert. Auch wenn
nachtaktive Geckos in der Nahrungskette ihrerseits fressen, was ihnen vor ihr
breites Maul kommt, darunter Heuschrecken, Käfer, Termiten, Küchenschaben,
Mäuse und junge Ratten und auch vor kleineren Geckos nicht Halt machen, sind
sie nützlich, und wenn einer von ihnen nicht gerade an der Decke über meinem
Bett turnt, sind sie gern gesehene Hausgäste und haben es nicht verdient, zu
Placebo-Medizin verarbeitet zu werden. Den Geckos auf der Farm droht
jedenfalls keine Unbill mehr.
Mannheim/Ladenberg, 17./19. Juni 2013
Dreharbeiten bei Jutta Benz, der Urenkelin von Carl und Bertha Benz. Thema:
Wie Bertha und ihre Kinder die Erfindung von Carl ins Rollen brachten, und
warum diese Geschichte eine Frühzündung des Situationsansatzes darstellt. Der
wird in Berlin im Oktober aus Anlass seiner vierzigjährigen Geschichte mit
einer internationalen Konferenz zum Thema „Zukunft gestalten“ gefeiert
werden. Mit im Team: Manuel, mein Sohn, Dokumentarfilmer, Manfred
Schönebeck, Direktor des Instituts für Innovationstransfer an der Internationalen
Akademie, und auf einen Sprung auch die Filmemacherin Elena Kleiber.
Das Haus von Jutta Benz in der Schlettstadter Straße in Mannheim wird von
einem kleinen Garten umrahmt, der von tropischer Fülle ist und in den nächsten
Tagen Drehkulisse und Ort intensiver Gespräche sein wird. Dass die Kamera
dabei läuft, gerät eher in Vergessenheit.
Als Bertha 1849 geboren wird, schreibt ihre Mutter in die Familienbibel, der
liebe Gott habe den Eltern leider wieder nur ein Mädchen geschenkt. Von wegen
„nur“! 1867 trifft sie den mittellosen Ingenieur Carl Benz, in den sie sich
verliebt. Später erzählt sie, sie sei der erste Mensch gewesen, der erfahren habe,
dass ein Auto gebaut werden sollte. 1870 verloben sich die beiden. 1872 gerät
Carl Benz in einer mit August Ritter gegründeten kleinen „mechanischen
Werkstätte“ in finanzielle Turbulenzen. Bertha lässt sich von ihrem Vater
vorzeitig ihre Mitgift und einen Teil des Erbes auszahlen und rettet die
Werkstatt.
Ich stelle mir meine englische Urgroßmutter vor in ihrer Villa Duncklenberg in
Wuppertal-Elberfeld, verheiratet mit Carl Duncklenberg, dem Fabrikanten und
Färbereibesitzer: Angesichts versteifter Vorstellungen über richtiges Verhalten –
man gibt seine Mitgift nicht her, bevor der Hafen der Ehe erreicht ist – wirkt der
Schritt von Bertha höchst ungewöhnlich.
1879 beginnt Carl Benz mit der Entwicklung eines Verbrennungsmotors. 1883
stürzt er ökonomisch abermals ab. Bertha legt in der Werkstatt selbst Hand an,
es sind, wie sie später schreibt, die „schlimmsten und entbehrungsreichsten
Jahre“. Immerhin: Carl beginnt mit der Konstruktion eines Motorwagens. Der
stottert bei den ersten Fahrversuchen zwei Jahre später, und Bertha ist mehr mit
Autoschieben als mit Autofahren beschäftigt. 1886 wird der Wagen patentiert.
1888 ist ein entscheidendes Jahr. Der Bau der neuen Fabrik in Mannheim steht
vor dem Abschluss, und das „Modell 3“ des Autos wartet auf seine Nutzung.
Carl hat keine Fahrerlaubnis. Der Kaiser und die Kirche sind gegen die neue
Erfindung; der Kaiser, weil er Pferde liebt, und die Kirche, weil sie das Auto für
Teufelswerk hält.
Ohne ihrem Mann Bescheid zu sagen, klettert an einem frühen Morgen im
August Bertha mit ihren beiden Söhnen auf den Motorwagen, der „Parkbank auf
Rädern“ (so ein amerikanischer Fan), und macht sich auf den Weg von
Mannheim nach Pforzheim. Was nun geschieht, kann man mehrfach
beschreiben: als Pioniertat des Marketing, als Unternehmensgeist, Resilienz und
Durchhaltevermögen einer Frau, die „leider wieder nur als Mädchen“ geboren
wurde, als eine erfinderisch Lernende in Ernstsituationen.
Hier geschah, was den Situationsansatz kennzeichnet: Lernen als Abenteuer,
entdeckendes Lernen, Lernen anhand realer Probleme.
Die Fahrt von Mannheim nach Pforzheim über eine Wegstrecke, die heute keiner
mehr genau kennt, ist eine mit vielen Stolpersteinen: Wo geht es überhaupt nach
Pforzheim, an Bahnstrecken und Flüssen entlang? Wo bekommen Bertha und
ihre Söhne unterwegs den Kraftstoff her? In Wiesloch? Dort verkauft eine
Apotheke ein Reinigungsmittel mit dem Namen Ligrosin, das sich dafür eignet.
Und was tun angesichts der verstopften Kraftstoffleitung? Bertha nimmt ihre
Hutnadel und stochert durch. Und die defekte Elektroleitung? Bertha nimmt ihr
Strumpfband und benutzt es als Isolierband. Die Antriebskette repariert ein
Dorfschmied in der Nähe von Bruchsal.
Als Bertha und ihre Jungen am späten Abend in Pforzheim ankommen und Carl
von dem Abenteuer per Telegramm – „Fahrt gelungen“ – erfährt, hängt der
Haussegen schief. Auf der Rückfahrt erfindet Bertha noch schnell die
Bremsbeläge und lässt in Bauschlott den Schuster die abgescheuerten
Bremsklötze mit Leder beschlagen. Später dann hängt der Haussegen wieder
gerade, weil sich nun mehr und mehr Käufer des Patent-Motorwagens einfinden.
Im Garten von Jutta Benz lassen wir die Geschichte Revue passieren, und weil
Jutta Französisch und Geschichte studiert und als Lehrerin gearbeitet hat,
diskutieren wir auch über die Entfesselung des Lernens, ein Lernen im Vor und
Zurück, im Versuch und Irrtum, im Zickzack, mit kaum prognostizierbaren
Verläufen (
http://www.vimeo.com/76317995).
Wir fahren nach Ladenberg. Dort befindet sich das „Automuseum Dr. Carl
Benz“, und dort steht der Nachbau des Wagens, mit dem Bertha die lange
Strecke fuhr. Der Wagen ist ein Kunstwerk. Jutta ist bereit, ihn auf dem
Museumsgelände zu fahren. Wir schieben ihn aus der Halle, die mit Autos aus
unterschiedlichen Zeiten der Benz-Geschichte liebevoll bestückt ist.
Winfried Seidel, der Museumsbesitzer, versucht, das Schwungrad des Gefährts
zu beschleunigen und den Motor zu starten. Es ist warm draußen. Und je
wärmer es ist, desto schwieriger wird es, den Motor anzulassen. Das ist auch mit
dem Nachbau nicht anders als mit dem Original des Jahres 1888. Aber dann
tuckert der Wagen los, fährt ums Eck und wieder zurück, und während Manuel
die Szene dreht, kommen mir Bilder aus Kristianstad in Südschweden in den
Sinn, als ich als Fünfzehnjähriger zu Besuch bei meinem Schulfreund Carl
Slättne war und wir den legendären Fangio beobachteten, wie er auf einer nicht
weit von Carls Bauernhof gelegenen Rennstrecke seine Formel-1-Runden
drehte.
Bertha und Carl: ein starkes Paar. Ich wünsche mir viele kleine Berthas und
Carls unter den Kindern der School for Life, Kinder, die sinnieren und tüfteln,
die beharrlich und risikobereit sind und nicht von Pädagogen ausgebremst
werden.
Jutta Benz, die in ihrem Temperament ihrer Urgroßmutter ähnelt, die ihre
Lehrjahre in der Frauenbewegung absolviert hat – Blessuren durch dogmatische
Fraktionen eingeschlossen – ist die jüngste und letzte der Benz-Familie, die die
Geschichte noch aus den Überlieferungen und Erzählungen ihrer Familie
berichten kann.
Bertha hatte zuletzt am Sinn der Erfindung des Autos gezweifelt und geweint,
als sie 1944, im Jahr ihres Todes, einen verwundeten Soldaten sah. Sie meinte,
dass die Erfindung des Autos Schuld am Krieg haben könnte. Über dieser Frage
mussten wir schon als Schüler brüten, wenn das Aufsatzthema „Fluch und Segen
der Technik“ hieß und uns nicht viel mehr als ein „sowohl“ als „auch“ einfiel.
Das Auto von Benz und Daimler diente dem Kaiser, der dann doch nicht nur
reiten wollte, es diente Hitler und den Potentaten dieser Welt. Es wurde
mitverursachend für städtebaulichen Wahnsinn und für den Verlust von
Lebenszeit durch sinnloses Warten im Stau und den Verlust von Leben durch
ungezählte Unfälle. Jutta Benz hat in einem Interview gesagt, nun komme es auf
eine neue Entdeckung der Langsamkeit an, auf eine neue Vision der Gestaltung
von Mobilität.
School for Life, 2. Juli 2013
Rings um das Farmhaus wachsen weiße, schwarze und braune Bohnen. Jeden
Nachmittag ist eine Gruppe von Kindern dabei, die Beete zu pflegen und zu
erweitern, Stangen zu stecken, Bänder zu ziehen, zu harken und zu hacken,
damit die Bohnen gut wachsen. Kein Erwachsener ist zu sehen.
Im fernen Bangkok brütet man im Ministerium über einen neuen Lehrplan. Im
Jahr 2015 werden sich die ASEAN-Länder dichter zusammenschließen, und
deshalb ist die School for Life schon jetzt dabei, diese Entwicklung zum
pädagogischen Thema zu machen. An zehn Bäumen hängen meterlange
Plakatfahnen, für jedes ASEAN-Land eine, und darauf sind Bilder und Texte
gedruckt, die jedes Land vorstellen: liebevoll ausgestaltet, ein informativer
bunter Fahnenwald. Allerdings – wer ist auf dem indonesischen Blatt mit
kleinem Foto zu sehen? Suharto. Dass dieser Diktator vor Jahren weggespült
wurde, ist im abgelegenen Teil des königlichen Forstes noch nicht angekommen.
Macht nichts. Die Kinder werden sich die Namen von Präsidenten in anderen
Ländern ebenso wenig merken, wie ich die Nebenflüsse der Donau aufzählen
könnte.
Überraschend fand ich Mitte der 80er Jahre in einem Kindergarten in Jakarta,
dass Kinder auf meine Frage, wie denn die Hauptstadt Indonesiens hieße, mit
„New York“ antworteten.
Im nächsten Jahr wird es in der School for Life wie in anderen thailändischen
Schulen einen neuen Lehrplan mit acht (statt bisher fünf) Kernfächern geben.
Das erstaunlichste Fach heißt „ASEAN Innovation“. Ich habe noch keinen
Namen eines Schulfachs gesehen, der so weit nach vorne weist. Er ist Ausdruck
des Selbstbewusstseins, und würde man nach einem psychologischen Pendent
bei uns suchen, würde das Schulfach vielleicht „Schreck lass nach – Europa“
heißen.
Peter Wolters ist zu Besuch auf der Farm und steht der School for Life mit Rat
und Tat zur Seite. Er ist Direktor des School for Life Instituts an der
internationalen Akademie (INA gGmbH) in Berlin. 1968 war er einer meiner
ersten Studenten an der Hochschule der Künste in Berlin, der Schreck patinierter
Hochschullehrer, Studentenführer und zusammen mit seinen Kommilitoninnen
und Kommilitonen Verfasser des ersten (ein bisschen) revolutionären
Hochschulcurriculum, das erst in den Semesterferien vollendet wurde, während
ich schon anderswo war. Irgendwo muss es – war es im Schlusskapitel oder in
begleitenden Flugblättern – einen Passus gegeben haben, in dem sinngemäß
stand, die Studenten seien im Übrigen der Auffassung, dass der Etat der
Hochschule der Künste der Kunst auf der Straße – will sagen – dem
Straßenkampf überantwortet werden sollte. Damals stand ich auf dem ersten
Platz einer Berufungsliste, und nachdem der Berliner Wissenschaftssenator dies
alles gelesen hatte, war es aus mit der Berufung.
In den Jahren danach habe ich die Leitung der Arbeitsgruppe Vorschulerziehung
im Deutschen Jugendinstitut in München übernommen. Ich lernte, dass nicht nur
Studenten, sondern auch Nonnen in Caritas-Kindergärten in Rheinland-Pfalz
konkrete Utopien entwickeln und Situationen von und mit Kindern zum
Besseren wenden wollten.
Peter Wolters eckte bei der Bundeswehr an, hatte Schwierigkeiten, verbeamtet
zu werden, wurde Schuldirektor und Oberschulrat und Leiter eines Master-
Studienganges für Schulmanagement an der Universität Potsdam.
In der Zeit um 1968, als die revolutionär gestimmte Studentenvertretung der so
gar nicht revolutionären Hochschule der Künste einen Lehrauftrag für mich
durchboxte, war ich vergnügt darüber, dem Wissenschaftstempel des Max-
Planck-Instituts für Bildungsforschung bei dieser Gelegenheit zu entkommen.
Mein Lehrauftrag, so die Studenten, sollte heißen: „Kunst, Psychoanalyse und
Revolution.“ Das Seminar war rappelkistenvoll, und da zu der Zeit die „Wiener
Exilregierung“ mit der „Wiener Gruppe“ und den „Wiener Aktionisten“ in der
Stadt weilte, lud ich zwar nicht Hermann Nitsch mit seinen Anfängen des
„Orgien-Mysterien-Theaters“, aber – eher aus Versehen und in Unkenntnis, was
er vorhatte – den Aktionisten Otmar Bauer ein, der sich mit einem Teller
Spaghetti und einer Flasche Bier vorne aufs Podium setzte, die Spaghetti in sich
hinein stopfte, das Bier austrank, sich danach den Finger in den Hals steckte,
alles erbrach und begann, das schleimige Gemisch erneut aufzuessen. Süßsaurer
Geruch breitete sich im Hörsaal aus, ich beobachtete, wie die Rixdorfer
Gruppe, die unter den Zuschauern war, in Deckung ging. Und ich zweifelte, ob
wir dem Ziel des Seminars, mit der Revolution erst einmal bei sich selbst
anzufangen, nun näher gekommen waren.
Es war die Zeit, in der ein Vorstandsmitglied von Schering sich am Wochenende
alte Klamotten anzog und auf Trödelmärkten Fleischwölfe sammelte, während
seine Frau Experimentalfilme mit den Wiener Aktionisten drehte. In jenen
Jahren war ich mit Gerhard Rühm befreundet, dem kompromisslosen
Miterfinder der „konkrete Poesie“, dessen Mundarttexte („mia geds in da wöd
zua oag zua“) ich bis heute bewundere.
Zur „Wiener Exilregierung“ gehörten auch H.C. Artmann und Ossi Wiener, der
die „Verbesserung von Mitteleuropa“ geschrieben hatte und mit mir über
ungewönliche Forschungsabsichten diskutierte. Am Paul-Linke-Ufer in
Kreuzberg gründete er das Lokal „Exil“, eine kulinarische Tradition, die heute
von seiner Tochter Sarah Wiener fortgeführt wird. Günter Brus, Wiener
Aktionist im Berliner Exil, nagte damals am Hungertuch und freute sich über
Einladungen zum Abendessen. Einmal brachte er die Estausgabe der
„Schastrommel“ mit, die heute in Galerien gehandelt wird. Brus war 1970 in
Wien zu sechs Monaten Haft verurteilt worden, weil er zusammen mit Ossi
Wiener und anderen im Audimax der Wiener Universität die Aktion „Kunst und
Revolution“ durchgeführt hatte, eine Aktion, die als „Uni-Ferkelei“ in die
Universitätsgeschichte einging und in einer Pressekampagne Günter Brus den
Titel „meist gehasster Österreicher“ einbrachte. – 26 Jahre später erhielt er den
„Großen Staatspreis für Bildende Kunst“, und heute hat Brus in Graz ein eigenes
Museum, das „Bruseum“.
Die Treffen der „Wiener Exilregierung“ waren so amüsant wie monoman. Man
redete über sich und nochmal über sich und beklagte die Verhältnisse, die
immerhin zuließen, dass alle viel Spaß dabei hatten. Gerhard Rühm, der später
eine Professur an der Hochschule der Künste in Hamburg übernahm und 2010
mit der Ehrendoktorwürde der Universität zu Köln ausgezeichnet wurde, hat
nicht nur umwerfend gute Texte geschrieben („die frösche“), sondern auch
ausgefallene Ideen für Hörstücke entwickelt, mit denen er nicht immer bei den
Rundfunkanstalten landete, zum Beispiel dann nicht, wenn seine Freundin
Mechthild Rausch und deren Freundin einen Kriminaltext ins Aufnahmegerät
spRachan, während sie sich wechselseitig zum Orgasmus zu bringen versuchten.
Das war friedliche Anarchie in der Berliner Bohème und eine andere Welt als
die einer sich zunehmend fraktionierenden Studentenbewegung.
Eines Tages erschienen einige Studenten meines Seminars nicht mehr mit ihren
wilden Frisuren, sondern kurzgeschoren, mit Anzug und Krawatte. Es sei jetzt
an der Zeit, in die Fabriken zu gehen und mit der Arbeiterklasse den Aufstand
einzuleiten. Ich sah sie nie wieder.
Nur Peter Wolters tauchte wieder auf, nach vielen Jahren Arbeit im
Brandenburgischen Kultusministerium, einigen Jahren Erfahrungen in Vietnam
und mit seiner vietnamesischen Frau Thuy, die sich im Auftrag der Shaul und
Hilde Robinsohn Stiftung um die buchhalterische Seite der Spendenverwaltung
zugunsten der School for Life kümmert.
Peter Wolters hat das studentische Curriculum der Berliner Hochschule der
Künste wieder ausgegraben. Anfang Oktober, auf der Konferenz „Zukunft
gestalten“ will er es vorstellen. Ich rechne mit einem hohen Unterhaltungswert.
Sukothai, 12. / 14. Juli 2013
Dha ist an einem Tag Dorfpolizist und am anderen Tag Reisbauer. Heute ist ein
Farmtag. Ein paar Kilometer von Sukhothais berühmtem Weltkulturerbe, dem
Historischen Park, entfernt, hat er seine Felder bestellt und dafür gesorgt, dass
das Wasser abfließt, denn es ist Regenzeit. Gegen 17:00 Uhr holt er mich vom
Flughafen ab, und der ist eine Puppenstube im Vergleich zu Bangkoks
Suvarnabhumi. Während der einstündigen Fahrt fallen mir die schönen
Holzhäuser am Wegesrand auf. Ich wundere mich, dass der Polizist Dha sich
nicht anschnallt. In Sukhothai will ich prüfen, ob der Ort eine Station auf der für
nächstes Jahr geplanten Reise sein kann, die wir für Gäste aus Deutschland aus
Anlass des zehnjährigen Bestehens der School for Life vorbereiten.
Eigentlich wollte Dhas Familie zur Begrüßung einen dicken Fisch grillen, weil
aber der Markt wegen des Regens heute ausfiel und kein Fisch gekauft werden
konnte, lade ich die Familie ein und sage, es sei an ihnen, ein Lokal ihrer Wahl
vorzuschlagen. Die Antwort kommt rasch: „MK!“ Nun ja, „MK“ ist eine
Restaurantkette, die in Thailand zum Beispiel dort zu finden ist, wo es ein „Big
C“ gibt, ein riesiges Einkaufszentrum mit weiteren Restaurants nichtthailändischer
Art, von „Mister Donuts“ bis „Svensen’s“. „MK“ zeichnet sich
dadurch aus, dass auf jedem Tisch ein Topf mit sprudelnd heißem Wasser steht,
in dem man allerhand fade schmeckende Zutaten, die in kleinen
Plastikschälchen geliefert werden, garen kann, um sie danach in eine rote Soße
zu stippen und zu verspeisen. Unter den Zutaten sind wabbelige, nach gar nichts
schmeckende Pilze und – aus was auch immer – gepresste Fischchen, die
ebenfalls nach gar nichts schmecken. Und wem das nun überhaupt nicht mundet,
der kann sich in die Bestellung von Entenstreifen auf grünen Nudeln retten und
unter Vermeidung der ebenfalls nach nichts schmeckenden Nudeln die
Entenstückchen in eine so làlà schmeckende braune Soße tunken.
In einer anderen Familie habe ich folgende Variante erlebt: Am Samstag „MK“,
am Sonntag ein nordthailändisches Frühstück mit „sticky rice“, scharf
zubereiteten Pilzen, gut gewürztem Eieromelett und Mangosalat. Wunderbar.
Und dann holt die junge Mutter eine Kartonschachtel, die sie am Tag zuvor bei
„Mister Donut“ gekauft hat, spült die Ameisen weg, die es sich über Nacht gut
gehen ließen, und gibt ihrer zweieinhalbjährigen Tochter ein klebriges, mit rosa
Paste überzogenes Gebäck, während der Rest der Familie andere Gebäckstücke
aus der Box nimmt und verspeist. Mein Hinweis, dass kleine Kinder davon auf
Dauer schwarze Zähne bekämen, wird bejaht, und es wird weitergefuttert. – Die
Krebsrate steigt auch in Thailand.
Die Familie des Dorfpolizisten ist kein Einzelfall. Mir ist das vom Süden bis
zum Norden Thailands mit anderen Familien passiert, und es ist mir
unerfindlich, wie Thais die Kunst einer variationsreichen Küche mit abgestuften
Schärfegraden plötzlich vergessen und sich mit Heißhunger auf eine Abart von
Küche stürzen, bei der nur die rote und braune Soße nach irgendwas schmeckt.
Je länger der Abend dauert, und je mehr Singha Beer Dha geschluckt hat, desto
besser wird sein Englisch. Er gehört zu den Polizisten, die nicht korrupt sind.
Denn wäre er es, würde er nicht jeden zweiten Tag, Sonntage eingeschlossen,
auf seinen Feldern schuften. Polizisten auf den unteren Rängen erhalten wenig
Lohn, und deshalb ist zu beobachten, dass gegen Monatsende die
Straßenkontrollen zunehmen und Polizisten insbesondere die zahlreichen
Motorradfahrer abkassieren, die immer noch ohne Helm durch die Gegend
brausen. Mit meinem Pickup werde ich meistens durchgewunken, wohl auch
deshalb, weil der normale Polizist des Englischen nicht mächtig ist. Als ich mit
einem geliehenen Wagen einmal angehalten wurde, weil trotz fortgeschrittenem
Jahr immer noch keine Steuerplakette an der Windschutzscheibe klebte, gab ich
dem Polizisten mein Handy, und es entspann sich ein längerer Dialog mit dem
Besitzer des Autos über die Preisgestaltung. Umgerechnet 10 Euro hatte ich
danach zu zahlen.
Das thailändische Essen gibt es am nächsten Abend unter dem Vordach des
Hauses, in dem Dha mit seiner Familie wohnt: ein großer Holztisch, drumherum
ein Dutzend abgesägter Baumstämme, auf denen man sitzen kann. Das
eigentliche Haus beginnt dreieinhalb Meter über uns, in
überschwemmungssicherer Höhe: ein anderes Konzept als das unserer
Architekten, die in gefährdeten Gebieten von der Ölheizung im Keller bis zu den
Einbauküchen im Erdgeschoss so gebaut haben, als kämen
Jahrhundertüberschwemmungen nie und schon gar nicht alle paar Jahre vor. In
Dhas Haus fließt das Wasser einfach darunter durch, und nach oben gerettet
werden muss eigentlich nur der große Flachbild-Fernseher, das einzige
Luxusstück im sonst eher karg möblierten Erdgeschoss.
Nach dem Abendessen ist Fernsehen angesagt: auf 300 Thai-Kanälen läuft
zumeist Schrott. Aber heute gibt es die Übertragung eines Fußballspiels
zwischen Manchester United und den „Singha All-Star“ – ein Bindestrich zu
viel und ein ‚s‘ zu wenig. Ein ‚s‘ als letzter Buchstabe ist unbeliebt. Deshalb
sagt man zum Beispiel nicht „Joy’s House“, sondern „Joy Hou“, und wenn man
einen Bohrer kaufen will auch nicht „Bosch“, sondern „Bo“.
Das Stadion ist randvoll. Rot auf allen Rängen. Es sind nicht die „Red Shirts“,
die gegen die „Yellow Shirts“ antreten, sondern thailändische Anhänger von
„ManU“. Dieser Club hat Thailand, was Marketing und den Vertrieb von
Accessoires angeht, fest im Griff. Bayern München oder Borussia Dortmund
können so gut spielen wie sie wollen, sie sind in Asien wenig präsent. Aber
warum ist im Stadion keiner für die „Singha All-Star“? „ManU“ lässt sich an
diesem Abend von den „Singha All-Star“ mit 0:1 abservieren. Die Spieler
verlassen mit hängenden Köpfen den Platz. Oder tun sie nur so? Geht das hier
mit rechten Dingen zu? Ist dieser britische Club inzwischen so schlecht, dass er
gegen eine zusammengewürfelte Mannschaft aus Thailand umstandslos verliert?
Und – welches neokoloniale Wölkchen schiebt sich über das Stadion, wenn
60.000 Zuschauer eine ausländische Mannschaft und nicht die aus dem eigenen
Land anfeuern?
Am Tag darauf steht der Historische Park auf dem Programm. Der Eintritt kostet
60 Baht für Thais und 100 für Ausländer – das sollte man sich mal bei
Besuchern der Berliner Museumsinsel vorstellen, mit erregten Engländern und
schimpfenden Italienern. Schon, schon, die Ruinen früherer Pracht und
vergangener Kämpfe des 13. und 14. Jahrhunderts sind beeindruckend, aber
wirklich lebendig wird das alles erst während des Festes Loi Kathong, wenn die
schwimmenden Lichter die verzweigten Gewässer der Tempelanlagen
erleuchten und der Park von festlich gekleideten Menschen belebt wird.
Es gibt den beeindruckenden Film „Suriothai“, der von Than Muy, einem
Mitglied der königlichen Familie gedreht wurde, und dessen neunstündige
Originalfassung von Francis Ford Coppola auf eine zweistündige Version
zusammengeschnitten wurde, um einem internationalen Publikum eine Ahnung
davon zu vermitteln, was in Thailand vor langer Zeit geschah. Es waren vor
allem die kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Burmesen, damals mit
einer invasionswütigen Armee, die auch die Tempel von Sukhothai zerstörte.
Heute sind die Burmesen die Gastarbeiter Thailands, und es gibt nahezu keine
größere Baustelle, auf der nicht auch Burmesen am Werk wären.
Als nachmittags die kleine Maschine aus Bangkok landet, um eine halbe Stunde
später wieder zu starten, parkt sie zwischen Blumen und Hecken versteckt in
einiger Entfernung von der kleinen Halle ohne Wände, die im Stil der alten Zeit
errichtet wurde. Ein kleines Feuerwehrauto fährt zum Flugzeug, und die
Feuerwehrmänner stehen Spalier, während die wenigen Passagiere, die ein
offener Bus mit reich verzierten Holzaufbauten hergebracht hat, einsteigen. Ein
Feuerwehrmann auf dem Flughafen muss wohl ein ähnlich beschauliches Leben
führen wie der Bahnhofsvorsteher von Wasserburg am Bodensee in den
fünfziger Jahren.
International Airport Phuket, 2. / 5. August 2013
Der Tourismus in Thailand explodiert. Für 2013 werden 26 Millionen erwartet, 7
Millionen mehr als 2012. Viele landen auf Phuket. Der Flughafen wird gerade
ausgebaut. Die Russen, erst vor kurzem zum stärksten Kontingent geworden,
werden derzeit von den Chinesen überholt. Es brummt nun das ganze Jahr über,
und Dellen im Aufkommen der Tourismusbranche gibt es nur, wenn die
Konflikte zwischen „Red Shirts“ und „Yellow Shirts“ zu heftig werden oder das
Militär – so ungefähr alle zehn Jahre wieder mal – für eine Weile die Macht
übernehmen sollte. Erfahrene Thailand-Reisende stört das nicht. Die Deutschen
kommen eigentlich nur während der Trockenzeit, weil in ihren Reiseführern
immer noch steht, dass die Regenzeit keine Reisezeit sei, was ausgekochter
Unsinn ist. Denn in der Regenzeit ist die Luft klar, blüht und duftet es, und wenn
nicht gerade Dauerregen angesagt ist, dann erfrischt ein kurzer Schauer am
Nachmittag. Araber, die aus Wüstenregionen kommen, finden die Regenzeit
sowieso attraktiver.
Nicht weit vom Flughafen entfernt liegen die Camps der burmesischen und
kambodschanischen Wanderarbeiter. Eines der burmesischen Camps besuche ich
öfter, ich kenne die meisten, weil ich gelegentlich dabei war, wenn es galt, einen
Arbeiter ohne Papiere bei der Polizei auszulösen und ihm eine Arbeitserlaubnis
zu verschaffen. Das ist ein hürdenreicher Weg, der dann doch zum Erfolg führt,
weil Thailand die Arbeitskräfte dringend braucht. Nicht nur am Flughafen wird
gebaut, sondern auch in vielen Buchten, und man kann schon darauf wetten,
dass eine wachsende Immobilienblase irgendwann wie in Spanien platzen wird.
Das Camp besteht aus einem Dutzend selbstgebauter Wellblechhütten. Wände
und Dächer: leichtes Blech, und wenn ein Windstoß kommt, scheppert das ganze
Dörfchen. Heute ist Hochzeitstag. Ein junger Mann und eine junge Frau
heiraten. Er hat sie im „Supercheap“ kennen gelernt, einer Art Flugzeughalle,
vollgestopft mit Billigwaren. Ich bin eingeladen, fahre zum Camp, das am
Rande einer Gummibaumplantage liegt, und werde in die Hütte des Brautpaares
gebeten. Auf einem Podest, das mit Plastikmatten belegt ist, hat sich das
Brautpaar in wunderschöner traditioneller Tracht niedergelassen. Die Stirnwand
ist mit Stoffen dekoriert. Zur Linken läuft ein Fernseher mit unscharfem Bild.
Weitere Möbel: keine. Ich werde gebeten, mich neben das Brautpaar zu setzen.
Es wird viel fotografiert. Draußen riecht es nach Festschmaus.
Getafelt wird an Plastiktischen, und weil immer mal wieder Regen aufzieht, sind
Plastikplanen über der Hochzeitsgesellschaft gespannt, einer Gesellschaft, die in
der Arbeitskleidung feiert, die auf der Baustelle getragen wird. Es gibt ein von
mir und anderen gestiftetes schwarzes Schwein, scharfes Hühnchenfleisch,
Gemüse, Reis, Thai-Whisky mit Soda, Bier, kleingeschlagenes Eis zur Kühlung
und supersüße Limonaden. Mädchen und Jungen, Teenager, schäkern
miteinander, schubsen sich und sondieren, wer denn nun mit wem
zusammengehen könnte, denn um zu heiraten – ohne Standesamt – braucht man
nicht älter als 15 oder 16 zu sein.
Aus Lautsprechern schallt Burma-Pop. Die Regenschauer nehmen zu. Es bilden
sich Täler im Zeltdach, in denen sich Wasser staut. Mit einer Stange bewegt ein
Mann das Dach nach oben. Und während der Regen schon Rinnsale durch
Tische und Stühle hindurch bildet, schwappt jetzt eine große Welle über den
leicht abschüssigen Platz, und die Hühner laufen hinterher und schauen, was der
Schwall an Insekten freigesetzt hat.
Die Burmesen dieses Camps sind Rundumkünstler. Sie arbeiten ungesichert
hoch oben auf den Gerüsten von Baustellen, können Kanäle und elektrische
Leitungen anlegen, Installationen vornehmen. Sie arbeiten hart und bekommen
300 Baht pro Tag dafür (etwa 7,50 €). Im Camp leben die Burmesen in Familien,
und wenn der Abend angebrochen ist, wird aus einem Wasserschlauch eine
Dusche, man hockt zusammen, kocht oder lässt, wenn der Thai-Boss auftaucht,
der ein bisschen wie Omar Sharif aussieht, Thai-Whisky, Soda, Eis und
chilischarfe Nüsse heranschaffen und den Mond, so er denn scheint, die
kostenlose Beleuchtung liefern.
Chiang Mai, 26. August 2013
Auf dem Flughafen von Chiang Mai kann man die „Tip-Zeitung für Thailand“
erwerben, und es lohnt einen Blick in dieses passagenweise in ziemlich
holprigem Deutsch verfasste 32 Seiten starke Journal. Die Nummer 8 im 17.
Jahrgang macht mit einem „Jet-Set-Mönch in Turbulenzen“ auf. Geschildert
wird die Gier des Mönchs Phra Wisapol Sukpol (ein Foto zeigt ihn in seinem
Privat-Jet), der sich ins Ausland abgesetzt hat, und dem der Staatsanwalt wegen
des Verdachts auf Geldwäsche, Veruntreuung, Betrug und sexuellem Missbrauch
auf den Fersen ist. So weit, so gut – der Fall ging durch die Medien.
Es folgen Polizei-, Wirtschafts- und Kulturnachrichten, ein Artikel über Nazi-
Schick („Hitlers Popularität ist ungebrochen“), eine Schelte („Die unfähige
Polizei“) und Voyeuristisches: „Prostitution: Minderjährige Burmesinnen
verhaftet“ oder auch „Sodom und Gomorra auf Koh Pangan“ – was man eben so
liest als deutscher Rentner in Pattaya oder am Patong Beach auf Phuket, solange
die Bars noch nicht offen haben.
Aber dann kommt es dicker: Ein Kolumnenschreiber namens Schmid ereifert
sich über „Die Horroraspekte ländlich-thailändischer Tischsitten“. Um seine
Attitüde des Kolonialdeutschen, der sich über die blöden Thais in seiner
Kolumne ungebremst auslassen will, ein bisschen zu kaschieren, zitiert er einen
„Ludwig“ („er möchte gern anonym bleiben“). Und der wiederum findet es
horrormäßig, dass sich Thais in der ländlichen Provinz Isan lieber im
Schneidersitz auf dem Boden niederlassen, dabei einen Kreis bilden, eine Matte
ausbreiten, die verschiedenen Gerichte in Schüsseln auf die Matte stellen und
mit den Händen essen. Das habe ich auch schon oft mitgemacht, wenn ich
irgendwo bei Farmern zu Besuch war; es ist ein vergnügliches Beisammensein,
und es bedarf einiger Kunstfertigkeit, mit einer kleinen Kugel aus „sticky rice“
das Essen zu sich zu nehmen, indem die Kugel als Besteck dient. Menschen die
den Schneidersitz nicht gewohnt sind, nehmen sich am besten einen kleinen
Hocker oder lehnen sich an eine Wand, um das Essen ohne wachsende
Schmerzen in den Gelenken oder im Rücken durchzustehen. Aber das ist unser
Problem und nicht das der Thais.
„Ludwig“ alias Schmid findet das alles eklig, und noch ekliger findet er, dass
sich diese Thais barfuß niederlassen („verschweißte Fußsohlen“) oder
zwischendurch mal zur Toilette gehen („Da weiß ich haargenau, dass die Hände
nach dem Geschäft mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht gewaschen
werden.“). Und selbst in Fällen, in den kein Klebreis, sondern gedämpfter Reis
verwendet wird und man sich mit seinem Löffel aus den Schüsseln herausholt,
was man gern essen will, wird „Ludwig“ alias Schmid vom Ekel geschüttelt,
weil er sich den am Löffel anhaftenden „Speichel des zahnlosen Opas“ vorstellt.
Dann wird die Gefahr von Hepatitis B und von Herpes Simplex beschworen und
bezweifelt, ob die blöden Thais überhaupt begreifen würden, was den Ekel von
„Ludwig“ alias Schmid eigentlich ausmacht. Je nun, Schmid, pack deine Koffer
und lass dich als Ausländer in der sauberen Schweiz nieder.
Denn mit der Schweiz geht es weiter im „Tip“. Ein Pierre K. hat die Schweizer
Nationalhymne in Richtung Fremdenhass umgedichtet, und das klingt dann
auszugsweise so:
„Vom Arbeitsamt, da komm ich her,
und weiß: Stellen gibt’s keine mehr!
Überall auf Stufen und Kanten,
sitzen Asylanten mit Verwandten!
Und draußen vor verschloss’nen Toren
stehen geduldige Schweizer, die Toren.
Und wie ich so gehe am Bahnhof vorbei,
da sehe ich nur Mannen aus der Türkei.
Sie feilschen und füllen mit Geld die Taschen,
da gucken wir dumm, wir Schweizer, wir Flaschen!
Dann fahr ich nach Hause mit Tram oder Bus,
vor mir sitzt ein wohlgenährter Russ.“
Es sind die Bumsfiderallala-Deutschen, die dieses Journal lesen, und so bietet es
denn auch ein Buchprogramm an, in dem alles das vorkommt, was den alternden
Lebemann mit dem kleinen Gehirn interessiert: „Wa(h)re Liebe“, „Erst 13“, „Ein
Narr im Paradies“, „Short Times“ oder – eben, eben – „So viele Mädchen, so
wenig Zeit“.
Bangkok, 27. August 2013
Nicht weit vom Regionalflughafen Don Muaeng liegt das „Rural and Social
Management Institute (RASMI), dessen Direktor Prof. Dr. Apichai Puntasen
Mitglied der School for Life Stiftung ist. Heute ist er der Gastgeber des
Vorstandes, der über mittelfristige Perspektiven der School for Life berät.
Und danach?
Ab nach Chinatown! Das ist Bangkoks lebendigstes Viertel. Gegen
18:00 Uhr werden auf den Bürgersteigen Tische und Stühle aufgestellt. Das
ganze Viertel: ein riesiger „Food Market“. Das verrückteste Restaurant, das mit
dem besten „Seafood“, heißt „Toys & Kids“ oder abgekürzt „T&K“. Man kann
zwischen Drinnen und Draußen wählen: Draußen gruppiert sich das Geschehen
um eine Ecke zwischen der Yaowaraj Road und einer der Seitenstraßen. Drinnen
geht es steile Treppen hoch; auf mehreren Etagen in relativ kleindimensionierten
Räumen mit aufgedrehter Klimaanlage drängen sich an Tischen Chinesen und
tafeln. Sie bestellen Krebse, Krabben, Langusten, Muscheln, Fische, Austern
oder Reis mit Krabbenfleisch versetzt, dazu Beer Chang oder Leo und reden so
laut, als müssten sie sich in einer Bahnhofshalle bei abfahrenden Zügen
verständigen. Wenn sie mit einem der Thais reden, weil irgendetwas fehlt,
sprechen sie Englisch, denn sie kommen nicht aus Thailand, sondern aus Hong
Kong, Peking, Singapore oder Taiwan. Es sind Kurzzeittouristen, die sich zu
Zig-Tausenden durch Chinatown schieben und die Gassen verstopfen, in denen
sich über Kilometer verteilt, Krimskramsstände aller Art befinden. Sie kommen
vielleicht, weil Chinatown in Bangkok noch so ist, wie es in Hong Kong oder
Shanghai einmal war. Die Goldläden in der Yaowaraj Road werden leergekauft,
und eine Unsitte hält sich leider nach wie vor: Haifisch-Rückenflossen werden
als Delikatesse angeboten.
T&K stellt keine Rechnungen aus, und auf die Frage, warum denn nicht, lautet
die Antwort: weil wir keine Steuern zahlen. Und das wiederum geht wohl nur,
wenn es einen Deal mit der Aufsichtsbehörde gibt und nicht nur T&K an den
Gästen verdient.
An diesem Abend haben sich drei Australier hierher verirrt. Nicht ganz: Denn
einer von ihnen – nennen wir ihn Alan – hat die beiden anderen eingeladen, er
muss ein Bangkok-Kenner sein, er schwärmt von diesem sehr besonderen Platz
und bestellt für die beiden, was er für die besten Leckerbissen hält. Aber er gerät
damit an die Falschen. Der eine Partner wird zunehmend zornesrot und blafft
Alan an, wie er überhaupt dazu käme, ihnen ein solches Essen in einem solchen
Lokal anzubieten, und je mehr Alan das Essen anpreist, desto wütender wird der
andere. Und nun halte ich es auch nicht mehr aus: Ganz auf die Verteidigung
von Alan bedacht, wechsle ich zum anderen Tisch, stelle mich höflich vor und
sage Alan, ich sei ganz seiner Meinung: dies sei das beste Lokal in Bangkok,
und entschwinde, während Alan mir dankbare Blicke hinterherwirft und der
Wüterich verstummt ist.
Draußen ist es heiß, auf der Straße ist vor lauter Autos im Stau und flanierenden
Menschen kein Durchkommen mehr. Nur die Tuktuk-Fahrer wissen noch, wie
man aus Chinatown zu dieser Abendstunde wieder herauskommt.
School for Life, 30. August 2013
Frage eines Gastes: Warum die Kinder abends mit Taschenlampen herumliefen,
obwohl doch der Hauptweg beleuchtet sei. Antwort: wegen der Schlangen. Dies
bringt uns zu der Frage, ob man von Schlangen gebissen werden könne: Mit
Radio Eriwan: im Prinzip ja. Nur ist das in den zehn Jahren des Bestehens der
School for Life noch nie passiert. Man muss schon drauftreten. Aber da
Schlangen die Vibrationen eines daherkommenden Menschenkindes spüren,
machen sie sich – wenn‘s geht – aus dem Staub, zumindest, wenn sie nicht giftig
sind.
Damals allerdings, als ich inmitten einer Gummibaumplantage auf dem Campus
der Beluga School for Life wohnte und nach Hause kam und mein kleines Büro
betrat, hatte sich eine schöne, vielleicht 40 cm lange, grüne Schlange auf einer
Reihe von Ordnern niedergelassen, die ich auf dem Boden abgestellt hatte. Sie
guckte mich an. Ich guckte sie an. Ich wusste, dass Giftschlangen finden, dass
sie es eigentlich nicht nötig hätten, das Weite zu suchen. Ich ging rückwärts
langsam aus dem Raum und rief zwei Arbeiter, um sich die Schlange anzusehen.
Da gerieten sie in Panik. Denn – wie ich später erfuhr – genügt ein Biss dieser
Schlange, um innerhalb von 10 Minuten unwiederbringlich im Jenseits zu
landen. Dann kam eine alte Frau aus der Nachbarschaft, sah die Schlange,
verschwand, kam mit einem Stock zurück und erschlug sie.
Mit Dr. Chanmongkol Trisri, damals Leiter des Center for Organic Farming,
diskutierte ich, dass das sicherste Mittel zur Vertreibung von Schlangen der mit
Sand vermischte Urin von Mungos sei. Schlangen hätten einen Heidenrespekt
vor Mungos, die wüssten, wie man selbst Cobras erfolgreich angreifen könne:
Ein Mungo, so zu sehen in YouTube, packt den Kopf der Schlange und dreht sie
und sich dabei so oft um die eigene Achse, bis die Schlange einen Drehwurm
bekommt und ermattet.
Chanmongkol bestellte zwei Mungos bei einem Händler. Der Plan war, unter
ihrem Käfig mit einem Drahtgitterboden ein Auffangbecken für den Urin
anzubringen und ein Sand-Urin-Gemisch im Kreis um die Häuser zu streuen und
so die Schlangen zu vertreiben. Als die bestellten Mungos eintrafen, waren sie
tot, und ihnen war das Fell abgezogen worden. Der Händler hatte gedacht,
Chanmongkol wolle die Mungos verspeisen. Gehäutet sehen sie aus wie
Kaninchen mit einem etwas längeren Schwanz.
Was für eine Unsitte, fanden Chanmongkol und ich, Mungos zu essen, statt sie
Schlangen vertreiben zu lassen! Aus war es mit dem Sand-Urin-Gemisch, aber
beruhigend war immerhin, dass sich Chanmongkol im kleinen Krankenhaus in
Thai Muang erkundigt hatte, wieviele Schlangenbisse man dort in einem Jahr zu
verarzten habe. Die Antwort war: ein Fall.
Wenn man die Straße von Chiang Mai Richtung Bangkok fährt, kommt man ein
paar Kilometer vor Lampan an einen Markt, der neben vielen anderen
kulinarischen Merkwürdigkeiten auch geschlachtete Mungos anbietet. Bloß
nicht kaufen, erkläre ich meinen thailändischen Begleitern, die mir wiederum
klarmachen wollen, wie gut Mungos schmecken. Wir einigen uns auf kleine
Maroni, schwarze kompakte Pilze und frittierte Reisfeldkäfer, die wie
vergrößerte Kakerlaken aussehen. Ich versuche, mich vor dem Verzehr zu
drücken und sage, ich sei „imläo“, was so viel wie „pappsatt“ heißt.
Wieng Chai, 3. November 2013
Kleine Beobachtungen im Supermarkt des nordthailändischen Provinzstädtchens
Wieng Chai – 2013 und Mitte der 1980er Jahre:
In der Abteilung „Zeitschriften“ damals wie heute jede Menge Lifestyle- und
Modejournale, bunt aufgemacht. Damals dominierten westliche Models; heute
dominieren asiatische. Eine Verrücktheit indessen ist geblieben: die massive
Werbung für „whitening creams“, „whitening deos“ und andere Weißmacher.
Helle Haut gilt in Thailand immer noch als schöner, während Deutschlands
Urlauber an Phukets Stränden versuchen, am Krebsrot vorbei direkt zu
gebräunter Haut zu gelangen.
Damals füllten sich die ersten Regale mit Tierfutter. Der proletarische, räudige
Straßenköter bekam aristokratische Konkurrenz: die Pudel voran,
Schoßhündchen aller Art folgten und später auch die Labradore – nur der Dackel
schaffte es nicht bis nach Thailand.
Den Kindern der School for Life sage ich „braun ist schön“ und erzähle ihnen
gelegentlich von Solarien bei uns, und dann lachen sie über die verrückten
Weißen. Und ich sage ihnen auch, dass breite Nasen genau so schön seien wie
schmale, aber das finden sie nicht. Und so warten wir weitere 30 Jahre ab, bis
westliche Touristen und einheimische Thais gemeinsam breite und schmale
Nasen, braune und weiße Haut schön finden.
Phayao, 14. November 2013
Das Taxi hielt vor dem Laden. Der Fahrer sprang heraus, rief nach der Frau im
Laden und öffnete vorsichtig die hintere Tür seines Wagens. Die Frau wurde
Zeugin einer Geburt. Das Baby war schon da, die junge Mutter lag erschöpft auf
dem Rücksitz. Die Frau aus dem Laden nahm das Baby; der Fahrer und
Passanten brachten die Mutter in den hinteren Teil des Ladens. Dort waren noch
ein Mann, eine alte Frau und zwei Kinder. So begann die Geschichte von
Benjawan. Sie war dem Tod von der Schippe gesprungen.
Was war geschehen? Die junge Mutter war 17 Jahre alt und bekam schon ihr
zweites Kind; der Vater des ersten war verschwunden, und sie gab das Baby in
die Pflege ihrer Tante. Auch der Vater des zweiten Kindes verdrückte sich, als er
merkte, dass seine Freundin schwanger war. Da wollte sie das Ungeborene töten,
schluckte ein giftiges Gebräu, bekam fürchterliche Krämpfe, aber das Kind
blieb. Als kurz darauf die Wehen einsetzten, deutete sie sie als weitere Krämpfe.
Sie wollte mit dem Bus ins Krankenhaus fahren, aber es reichte nicht mehr. Sie
hielt ein Taxi an. Und so kam das Mädchen Benjawan, das es eigentlich nicht
hatte geben sollen, zur Welt. Die Mutter wollte das Kind auch nach der Geburt
noch umbringen. Dazu kam es nicht mehr. Die Frau im Laden nahm beide auf,
weil sie fand, dass die junge Mutter sich um das Baby kümmern und es stillen
sollte. Eine Weile ging alles gut, aber dann machte sich die junge Mutter mit
einem neuen Freund auf und davon. Sie ließ das Baby einfach da. Die Frau im
Laden pflegte es und adoptierte es später. Einmal kam der leibliche Vater vorbei
und sagte, er habe ein Recht auf das Kind, in Malaysia gäbe es Leute, die dafür
viel Geld böten. Aber da wurde er aus dem Laden geworfen.
Benjawan hat nun einen richtigen thailändischen Vor- und Familiennamen, aber
gerufen wird sie wie das kleine Wikinger Mädchen, ein Naseweis, selbstbewusst
und blitzgescheit. Heute habe ich sie gesehen, und ich denke: Diesmal ist es kein
Fall für die School for Life.
School for Life, 20. März 2014 - Khaoleow, 12./13. April 2014
“Graduation Day”: Abschlussfeier für die 9. Klasse, Ende der Pflichtschulzeit,
auch wenn die meisten unserer Jugendlichen weiterbetreut werden, sei es bei der
Vorbereitung auf einen Beruf, beim Besuch der Senior High School im nahen
Doi Saket oder beim Besuch eines College in Chiang Mai.
Die Aula ist festlich geschmückt. Blumen über Blumen, AnspRachan, Gedichte,
Lieder, Tränen. Jeder umarmt jeden, und es ist nicht zu übersehen, dass einige
Jungen der 8. Klasse, die sich noch in der Phase „Mädchen, bloß nicht“
befinden, von den Mädchen der 9. Klasse umarmt werden wie junge Brüder, und
dass diese Jungen ihre Arme dabei herunterhängen lassen wie Bohnenstangen
und ihre Rührung doch nicht verbergen können.
Die Abschlusszeugnisse werden mit einem freundlichen Wai, dem
thailändischen Gruß, und guten Wünschen übergeben; das Ritual ist lockerer als
jenes Zeremoniell, das dann stattfindet, wenn ein Mitglied der Königsfamilie
Zeugnisse überreicht. Nun bindet jeder Erwachsene jedem der Schulabgänger
eine weiße Schnur ums Handgelenk, wiederum von guten Wünschen begleitet.
Zwei Dutzend Schnüre und viele gute Wünsche nimmt jedes Mädchen und jeder
Junge mit auf den Weg nach draußen. Dort, unter freiem Himmel auf dem
Sportplatz, werden viele Fotos gemacht, und ich lade alle, die nun zu Alumnis
geworden sind, ein, die Gemeinschaft der School for Life und die Farm auch in
Zukunft als Heimat und Familie zu betrachten und jederzeit wiederzukommen,
in guten wie in schwierigen Zeiten.
Ortswechsel, einen Monat später im Dorf Khaoleow, nicht weit von Phitsanulok.
Dort feiert eine Schule ihr 40-jähriges Bestehen. Um die 300 Alumnis sind an
diesem Abend gekommen. Mich haben die Ehemaligen eingeladen, die vor 30
Jahren nach der 9. Klasse abgingen. Auf dem Gelände sind Tische und Stühle
aufgestellt. Auf der Bühne treten Sänger auf, die Thai Pop zum Besten geben
und nach Karaoke-Art von Konservenmusik begleitet werden. Es wummert
mächtig aus den Lautsprechern, und oben rings um die Sänger bewegen sich
Tänzerinnen, die mit einem Repertoire von vielleicht einem Dutzend
unterschiedlicher Bewegungen ihre Arme schwingen und mit Vorwärts-,
Rückwärts- und Seitwärtsschrittchen als Ballettformation auftreten. Nur: Keiner
schaut hin, denn je mehr Alumnis eintreffen, desto mehr liegen sie sich mit
großem Hallo in den Armen und reden aufeinander ein. An meinem Tisch sitzen
der Bürgermeister eines Gemeindeverbunds, die Managerin eines Restaurants,
ein Antiquar, ein Autohändler, zwei Farmer, ein Landarbeiter – arme und
wohlhabende Alumnis.
Einige der alten Lehrer tauchen auf. Ob sie nun 75 oder 90 Jahre alt sind, lässt
sich schwer schätzen. In Thailand gehört es zu den raren Ausnahmen, graue
Haare zuzulassen. Sie werden schwarz gefärbt. Die Lehrer, kaum erkannt,
werden umarmt und auf die Wange geküsst. Die ehemaligen Schüler sagen, dass
sie sie lieben würden. Man muss 35 Jahre zurückblicken und sich von Alumnis
erzählen lassen, wie die Lehrer damals waren: Sie waren streng, manche
schlugen (so, wie zu meinen Grundschulzeiten) mit einer dünnen Gerte, nicht
schlimm, sagen die Ehemaligen, aber kombiniert mit viel Schimpferei. Damals?
Da waren sie unbeliebt. Und jetzt? Ein Herz und eine Seligkeit. „Warum liebt ihr
mich jetzt auf einmal?“ fragt ein alter Sportlehrer. „Weil du uns zum Ziel
bringen wolltest.“ Heute sind körperliche Strafen per Gesetz verboten, aber die
Neigung dazu ist noch da, auch weil viele Lehrer bisher über kein Repertoire
verfügen, das vom klärenden Dialog über die Mediation bis zu sozial sinnvollen
Strafen reicht.
Und 40 Jahre muss man zurückblicken, um zu verstehen, warum die Alumnis
des damaligen 10. Abschlussjahrgangs sich als Geschwister verstehen und sich
mit „Schwester“ oder „Bruder“ anreden. Damals waren sie alle bettelarm. Oft
reichte das Essen nicht. Dann überlegten sie, wer am nächsten Tag etwas
Essbares mitbringen könnte: Reis oder Gewürze oder einen getrockneten Fisch
oder Zuckerrohr, das einer von ihnen zuvor vom Feld stibitzt hatte. Besonders
gut schmeckten blaue Früchte; man musste hoch hinauf in einen Baum klettern,
um sie zu holen. Die Kinder bekamen blaue Zähne davon, und deshalb ließen
die Lehrer sie bisweilen antreten, riefen „alle mal lächeln!“ und schauten sich
die Zähne an. Denn es war verboten, auf den Baum zu klettern, aber es war der
Lieblingsbaum der Kinder, unter dem sie sich versammelten und ihr Essen
teilten.
Je später der Abend wurde, desto mehr erinnerte er mich an die Eingangsszene
der „Feuerzangenbowle“: die Herren am Tisch, von ihren Schulstreichen
schwärmend. Im Dorf Khaoleow gab es außerschulische Versuchungen zur
Genüge: Angeln zum Beispiel mit einfachem Gerät und großer Erwartung auf
den nächsten kleinen Fisch am Haken. Da geriet dann der Unterricht für diesen
Tag in Vergessenheit, und die Ehemaligen an meinem Tisch überkommt
Wehmut, wenn sie von den verlorenen Zeiten berichten.
Am Tag darauf – Songkran, das Neujahrs- und Wasserfest wird landesweit
gefeiert – sind Rachan, Samloew und Bunan, drei Freunde vom 10.
Abschlussjahrgang, im Auto unterwegs. Sie passieren einen Ort, in dem an jeder
Ecke Jugendliche auf Opfer warten, die sie mit Wasser aus Kübeln oder
Gartenschläuchen bespritzen. Ein Motorradfahrer kommt dem Auto entgegen.
Eine Gruppe am Straßenrand mit Eimern und großen Wasserpistolen bewaffnet,
zielt auf den Jugendlichen auf dem Motorrad. Der, nicht mehr nüchtern,
versucht auszuweichen, gerät in ein Schlagloch, knallt gegen das Auto, stürzt
und wird bewusstlos. Im kleinen Krankenhaus am Ort wird er notärztlich
versorgt.
Die drei Alumnis sind unterdessen auf der Polizeistation und erklären, was
vorgefallen ist. Ich besuche sie dort. Die Drei fahren mit mir danach zum
Krankenhaus. Wir wollen sehen, wie wir dem Verunglückten und seiner Familie
beistehen können. Als wir ankommen, treffen wir den angetrunkenen und
verwirrten Vater des Jungen und die geschockte Mutter. Ihr Sohn wird aus der
Notaufnahme auf einem Wagen liegend herausgefahren und in einen
Krankenwagen geschoben. Er soll, im Koma, in ein größeres und besser
ausgestattetes Krankenhaus verlegt werden. Ein Arzt erklärt, welche
Verletzungen der Junge erlitten hat: Er habe Blut in der Lunge, Brüche an
Armen und Beinen, Blut im Urin, wahrscheinlich innere Kopfverletzungen.
Die drei Alumnis beschließen, der armen Familie finanziell zu helfen, denn die
Versicherung wird nur einen Bruchteil der Kosten übernehmen. Dies, scheint
mir, ist ein überzeugender Teil asiatischer Kultur: mit der Familie des
Verunglückten Frieden zu schließen, auch wenn man selbst am Unfallgeschehen
nicht schuld war. Ich habe solche Friedensschlüsse auch auf Bali erlebt, und sie
haben mich weitaus mehr beeindruckt als der rasche Ruf nach den Anwälten,
wenn es auf unseren Straßen kracht.
Die Nacht vor dem zweiten Songkran-Tag überlebt der Junge nicht. Mit ihm –
meldet die „Bangkok Post“ – sterben auf Thailands Straßen während des Festes
276 Menschen, 2.926 werden verletzt.
Ein Weiler in der Nähe von Khaoleow, 14./15. April 2014
Ein junger Mann will Mönch werden, nicht für immer, aber doch für eine
längere Strecke seines Lebens. Das zweitägige Fest ist ähnlich bedeutsam wie
eine Hochzeit. Der Ort: ein paar Häuser, rings um einen Tempel gelegen. Der
Weg dorthin führt über flaches Land, an Wasserläufen entlang und über kleine
Brücken. Zu beiden Seiten Reisfelder, Hecken, Baumgruppen, keine Menschen.
Der Hof, von dem der junge Mann stammt, ist nicht zu überhören. Ein halbes
Hundert Menschen hat sich dort versammelt: Farmarbeiter, Familienmitglieder,
Nachbarn. Es ist noch früh am Tag, aber Whisky mit Eis und Soda wird schon
jetzt getrunken.
Die Musik dröhnt aus einem Gefährt, das mich an das Vehikel des Zampano
erinnert, der in Fellinis Film „La Strada“ mit Gelsomina über Land zog und als
grobschlächtiger Schausteller sein Brot verdiente. Dieses Gefährt auf dem Hof
sieht wie ein aufgetakeltes Tuktuk aus, eine dreirädrige, fahrbare Musikanlage.
Voluminöse Lautsprecher erzeugen eine Phonstärke, die jedes Gespräch
überflüssig macht. Das Herz des Gefährts besteht aus einem massigen Verstärker
mit zahlreichen Knöpfen und Schaltern, seitlich sind Timbales montiert, die
Percussion bestimmt das musikalische Geschehen, und zu tok-tok-ta-ta-ta-
Rhythmen spielen und singen drei, vier Musiker Thai Country Pop mit Texten,
die drastische Geschichten aus dem ländlichen Leben erzählen.
Der junge Mann, der Mönch werden will, sitzt derweil auf einem roten
Plastikstuhl und hält ein großes grünes Blatt auf dem Schoß, das wie ein
umgedrehter Regenschirm seine Haare aufnehmen soll. Denn die werden jetzt
abgeschnitten. Einer nach dem anderen nimmt eine Schere, schneidet drei
Haarbüschel ab und denkt dabei Gutes.
Der junge Mann ist 20 Jahre alt. Eigentlich müsste er zur Armee. Weil er aber
während der Schulzeit eine paramilitärische Ausbildung absolviert hat, ist er
davon befreit. Er wolle weg von zu Hause, sagt die Mutter. Sie würde zu viel
herumkommandieren, und das vertrage er nicht.
Am Abend werden 500 Gäste erwartet. In langen Reihen stehen Tische und
Stühle auf einem Sportplatz. Eine Bühne ist aufgebaut und die Lautsprecher
verheißen wiederum, dass Gespräche zwecklos sein werden. Aber es kommt
anders. Gegen 16:00 Uhr zieht von Westen her eine riesige pechschwarze
Gewitterfront auf. Die ersten Windstöße wirbeln Staub auf. Dann bricht ein
Orkan los. Der Regen: ein Wasserfall. Die Bühne bricht kRachand in sich
zusammen, Tische und Stühle kippen um, und die Menschen flüchten sich unter
die Dächer. Aber auch die bieten keinen Schutz, der Wind drückt das Wasser
durch alle Ritzen. Aus der Traum.
Nach etwa drei Stunden klart der Himmel auf und ich sehe auf dem Heimweg
Männer auf Motorrädern, die ihre Kampfhähne nach Hause fahren, Hähne, die
dieses Mal – dem Himmel sei Dank – nicht kämpfen mussten.
Am nächsten Tag wird frühmorgens nachgefeiert. Es sind nur 200 statt 500
Menschen da, und im Garten des Hofes ist es auch enger als auf dem Sportplatz,
aber das tut der Stimmung keinen Abbruch, zumal auf jeden Tisch wieder eine
Whisky- und mehrere Sodaflaschen stehen. Die Cowboys mit der
Musikmaschine spielen auf, und als nach einer guten Weile der junge Mann, der
Mönch werden will, in Weiß gekleidet und mit weißem Kopftuch versehen,
erscheint, wird er mit einem prächtigen Schirm vor der Sonne geschützt und ist
von nahen Verwandten umgeben, die in ihren Händen halten, was er in den
Tempel mitnehmen wird. Nun zeigt sich, warum die Musikmaschine auf Rädern
steht. Sie bildet das laute Zentrum einer Prozession, die sich zentimeterweise
voranbewegt und für die 200 Meter vom Hof bis zum Tempel zwei Stunden
braucht. Es wird getanzt und getanzt, ein Karneval auf dem Land, und
mittendrin der junge Mann, der eine kleine gelbe Kerze in der Hand hält.
Vorneweg laufen Frauen, die an Stangen über der Schulter Körbe voller
künstlicher Blüten tragen, in denen Geldstücke verborgen sind. Von Zeit zu Zeit
werfen sie sie in die Menge und freuen sich, wie die Menschen
durcheinanderwirbeln, um die Blumen zu erhaschen.
Inzwischen ist es brütend heiß geworden. Der Tempel ist erreicht. Nun wird er
dreimal im Schneckentempo umkreist. Der junge Mann, der heute Mönch
werden wird, hält die kleine gelbe Kerze immer noch in der Hand. Und dann
endlich kommen sieben Mönche, lassen sich im Tempel nieder, und mir wird
klar, dass es keine vierte Umrundung geben wird. Die Zeremonie findet nur im
kleinen Familienkreis statt, alle anderen stürzen sich auf das vorbereitete Buffet.
Einer erzählt mir, früher hätten sie den Tempel siebenmal umrundet, aber in den
modernen Zeiten seien die Leute fauler geworden.
Zurück in Khaoleow. Es ist der letzte Tag des Songkran. Rachan, Samloew,
Bunan, andere Alumnis und ich haben die Familie des Verunglückten besucht
und Geld gesammelt. Der Vater und die Mutter sitzen verloren vor einem leeren
Sarg – noch ist der Leichnam im Krankenhaus. Wir sprechen miteinander. Aber
was hilft das. Der Junge hätte wahrscheinlich überlebt, wenn er einen Helm
getragen hätte.
Am Abend hat Rachan zu sich nach Hause eingeladen. Es gibt ein
variationsreiches Essen. Frittierte Käfer bin ich schon gewohnt, und auch die
Ratten, die in kleinen Stückchen mit viel Gewürzen und einer scharfen Soße
serviert werden, schmecken nicht so, wie ich mir Rattenfleisch vorstelle. Und
überhaupt, es seien nicht die Stadtratten, sondern die Reisfeldratten, und die
seien sehr sauber, sagt Rachan.
An der Wand hängt eine Art Bogen, der mit einer kurzen Röhre aus Bambus
verbunden ist. Es wäre zu kompliziert, hier zu erklären, wie diese Rattenfalle
funktioniert, aber ich bekomme sie geschenkt und klemme sie in meinen Koffer
auf dem Weg anderswohin.
Phang Nga, 15. Mai 2014
Er heißt Didier le Bas, und ich treffe ihn durch Zufall. Er ist Kapitän großer
Yachten. Er stammt aus der Normandie. Als er so um die 15 Jahre alt war, ist er
von zu Hause abgehauen, hat angeheuert und ist zur See gefahren. Er hat Decks
geschrubbt und sich langsam hochgearbeitet. Er hat alle Weltmeere befahren und
als Kapitän seine Schiffe durch viele Stürme gebracht. Er hält nichts von
Kapitänen, die die seemännische Erfahrung durch Prüfungen und den Erwerb
von Zertifikaten ersetzen. Didier pfeift auf Prüfungen und Zertifikate. Die
Schiffskatastrophen der letzten Zeit in südkoreanischen und italienischen
Gewässern seien genau von solchen Papier-Kapitänen verursacht worden. Ich
frage ihn nach seinem Kapitänspatent. Er hat keins. Die Schiffseigner hätten
auch nie danach gefragt. Sie wollten nur wissen, welche Erfahrungen er
mitbringe.
Wenn ich Jugendliche der School for Life sehe, die über jede Menge an
lebenspraktischen Erfahrungen verfügen und keine Lust auf Prüfungen und
Zertifikate haben, dann werde ich ihnen künftig die Geschichte von Kapitän
Didier le Bas erzählen. Auch und vor allem die vom Anfang. Die Decks von
Schiffen zu schrubben ist Knochenarbeit.
Bangkok, 26. Mai 2014
Im Oktober 1976 putschte das thailändische Militär und veranstaltete auf dem
Campus der Thammasat University ein Massaker unter den Studenten. Die
Universität war damals ein Zentrum des demokratischen Widerstandes. Von
1976 bis 1980 tobte in Thailand ein Bürgerkrieg mit einer starken Guerilla
Bewegung. Apichai Puntasen, 1942 geboren, war 1976 Assistant Professor an
der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Nach dem Putsch ging er in den
Untergrund und ins Exil nach Australien und forschte an der Universität von
Melbourne. 1984 kehrte Apichai nach Thailand zurück, arbeitete als Professor
wieder an der Thammasat University und wurde 2001 zum ‚Eminent Professor
of Buddhist Economics‘ ernannt.
Wir trafen uns zum ersten Mal Mitte der 1980er Jahre in Dublin auf einer
Konferenz der International Community Education Association (ICEA), deren
Präsident ich später wurde, und befreundeten uns. Als Apichai (alle Thais reden
sich mit dem Vornamen an) mit einem von Günter Faltin vermittelten
Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes nach Deutschland
kam, entdeckten wir unsere gemeinsamen Bezüge zum großen brasilianischen
Pädagogen Paulo Freire („Pädagogik der Unterdrückten“) und diskutierten, wie
man das Thema „learning & earning“ durch die Gründung von Productive
Community Schools ins Zentrum rücken könnte. „Die Kinder der Armen als
Unternehmer verstehen“, hieß später ein Kapitel in dem mit Günter Faltin
zusammen verfassten Buch „Reichtum von unten“.
Ich lud Apichai nach Wasserburg am Bodensee ein, und als meine Frau Birzana
und ich mit ihm eines Tages einen Waldpfad am Flusslauf der Argen entlang
liefen und Apichai etwas zurückblieb und nicht nachkam, entdeckten wir ihn bis
zum Gürtel in einem Schlammloch steckend, befreiten ihn und fuhren – wie
vorgesehen – nach Lindau, wo er, zur Hälfte von einer Schlammkruste
überzogen, mit vollendeter Höflichkeit meiner Mutter einen Blumenstrauß
überreichte.
Ein gemeinsames Projekt führte uns in den Norden Thailands in die Nähe von
Maesalong, einer Ansiedlung nationalchinesischer Soldaten und ihrer Familien,
die vor den Truppen Maos geflohen waren. In dieser Gegend leben die Akha.
Man hatte sie in eng umgrenzten Gebieten angesiedelt, in denen es in der
Trockenzeit an Wasser mangelte. Die Dorfältesten hatten uns eingeladen. Sie
hatten Furcht vor den ersten Touristen, die die vom Militär geschlagenen
Schneisen nutzten, um mit ihren Motorrädern zu den Dörfern vorzudringen.
Dort gab es weder Strom noch Wasser. Gejagt wurde mit Vorderladern – mit
geringer Trefferquote und guten Überlebenschancen für Kaninchen und
Eichhörnchen. Die Kinder wurden von Militärs unterrichtet, und statt „ASEAN
Innovation“ ging es mehr um „counter insurgency“.
Ein korpulenter, mit beeindruckendem Rauschebart ausgestatteter australischer
Arzt, Bill, hatte sich uns zugesellt, der, als er von den Wasserproblemen der
Akha hörte, schwitzend, einem Moses ähnelnd, mit den Akha an den
Berghängen herumstapfte und kleine Wasserreservoire anlegte. Da die Akha
aber bemerkt hatten, dass er Arzt war, wurde er abends und nachts von Patienten
überrannt und starb offenbar vor Überanstrengung den Herztod (seine
Geschichte wird im Kapitel „Visionen verwirklichen“ in „Reichtum von unten“
ausführlicher erzählt).
Apichai und ich diskutierten noch zu Lebzeiten Bills mit den Dorfältesten in
mehrtägigen Zusammenkünften, ob man einen Zaun um die Dörfer ziehen und
die Touristen aussperren oder sich ein Konzept überlegen solle, das einen
kulturell sensitiven Tourismus fördern könne. Es entstand die Idee, eine
Akademie der Bergstämme zu gründen, um altes Wissen mit modernem zu
verbinden und die junge Generation stark zu machen, nicht Opfer, sondern
Mitgestalter einer behutsamen Modernisierung zu werden. Unsere Überlegung
war, die Akademie auch für Gäste zu öffnen und dadurch mitzufinanzieren. Ich
schrieb – unterstützt vom Goethe-Institut – einen Antrag ans Auswärtige Amt
auf Förderung einer „Akademie der Hilltribes“ in den Bergen von Maesalong.
Nach einer Weile kam die Antwort, dies sei ein interessantes Projekt, nur sei das
AA leider nicht in der Lage, unter der Rubrik „kulturelles Erbe“ Lebendiges zu
fördern. Eine Tempelruine, die hätte restauriert werden können, hatten wir aber
nicht zu bieten. Die Idee wurde später von Guarani-Indianern in der Nähe von
São Paulo aufgegriffen und ihre Umsetzung von einer schweizerischen Stiftung
gefördert.
Im Jahr 2000 wurden wir vom Bildungsministerium in Bangkok gebeten, eine
Studie über das ‚fünfte Rad am Wagen des thailändischen Bildungssystems‘
durchzuführen, die privaten Berufsschulen. Im Unterschied zu staatlichen
Berufsschulen verlangen sie Schulgeld, und diejenigen, vornehmlich aus
ökonomisch schwachen und bildungsfernen Familien stammenden
Jugendlichen, die wegen unzureichender Abgangsnoten in der 9. Klasse in keine
staatliche Berufsschule aufgenommen werden, müssen mit einer deutlich
schlechteren Variante der beruflichen Bildung vorlieb nehmen. Von einer dualen
beruflichen Bildung war damals noch nicht die Rede, und als ich dieser Tage mit
Jörg Buck, dem Executive Director der Deutsch-Thailändischen
Handelskammer über die damaligen Zustände sprach, meinte er, sie seien heute
nicht besser. Wir nannten den Bericht über die untersuchten Schulen „The
Development of Entrepreneurial Schools in Thailand“ und legten den
Schwerpunkt unserer Empfehlungen auf „entrepreneurship education“. Unsere
Beobachtungen zeigten, dass – wie anderswo auch – die in der Sekundarstufe II
angesiedelten Berufsschulen, sie werden hier Colleges genannt, Arbeitnehmer-
Qualifikationen im Blick haben, dass aber die Absolventen nicht darauf
vorbereitet werden, sich Arbeitsplätze selbst zu schaffen. Und wenn, dann
herrscht das „me too“-Prinzip vor: Einer eröffnet an einer neuen Ringstraße von
Chiang Mai ein Restaurant, und 95 andere tun das dann auch, weil das erste gut
lief, um dann – wie die Lemminge – in den ökonomischen Abgrund zu stürzen.
Es gab viel Zustimmung; eine nationale Berufsschul-Konferenz wurde
einberufen. Apichai schrieb: „Certainly, in one of his recent speeches, the
Minister of Finance implied that one of the major purposes of educational
reform in Thailand is to produce more entrepreneurs for the country in order to
enhance her competitive ability in the future.”
Und es schien ja Ansätze zu geben: In Kanchanaburi und Chiang Mai sahen wir
Vocational Colleges mit angeschlossenem Hotel- und Restaurantbetrieb. Aber
die Jugendlichen wurden dort nicht unternehmerisch qualifiziert, sondern lernten
nur Betten zu machen und das Besteck richtig hinzulegen. Nicht weit von
Chiang Mai trafen wir auf ein College, das sich der Landwirtschaft verschrieben
hatte. Dort gehörte es zum Standard, „Mini Companies“ zu gründen, allerdings
nur für den Zeitraum eines Schuljahres. Und wenn dann drei Jugendliche in
einer Mini Company gerade damit begonnen hatten, Hunde zu züchten, mussten
sie, ob sie nun erfolgreich waren oder nicht, ihr Kleinstunternehmen nach neun
Monaten schließen. Absurd.
Die Überlegung, eine Gruppe von privaten Berufsschulen zu „Entrepreneurial
Schools“ weiterzuentwickeln, haben Apichai und ich dann bald wieder
begraben. Monsterschulen mit 2.500 oder mehr Schülerinnen und Schülern
lassen sich schwer bewegen, und es gab und gibt in Thailand auch nicht das
Instrument „Modellversuch“, sondern allenfalls das Interesse privater
Investoren, Berufsschulen neuen Typs zu entwickeln.
Immerhin, das von uns vorgeschlagene Konzept wurde zur Basis der School for
Life und hinterließ auch anderenorts Spuren, beispielsweise im Versuch,
Productive Community Schools zu entwickeln, die das Thema Social
Entrepreneurship aufgriffen. Ich erinnere mich, wie Apichai und ich in
Nakornrachasima, im armen Osten, mit dem Kollegium einer Schule darüber
diskutierten, wie die Lehrer nach mehr Geld vom Staat fragten und Apichai der
Kragen platzte und er den Versammelten anempfahl, doch endlich einen Teich
anzulegen und Fische zu züchten und auch mit der Schweinezucht zu beginnen,
anstatt nur zu jammern.
Apichai hat heute mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: Arthrose, Krebs,
und was man eben so bekommen kann, wenn man, wie unsereiner, in die späten
Jahre kommt. In Gesprächen ist er wach und weise wie immer. Ohne ihn hätte
ich Thailand verpasst.
Chiang Mai, 27. Mai 2014
Nur ein paar Schritte vom Hotel „137 Pillars House“ entfernt, befindet sich ein
im Jahre 1428 erbauter Tempel, der Wat Gategaram. Der ist ein bisschen anders
als andere Tempel. Vor allem hat er ein Museum, das anders ist als andere
Museen; eher eine Mischung aus großem Dachspeicher mit vielen alten Sachen,
eher ein riesiger, verschachtelter Krimskramsladen, eher eine Asservatenkammer
für Kulturanthropologen, eher ein Fundus für Überraschungen. Faszinierend,
scheinbar unaufgeräumt, gleichwohl ein kulturgeschichtliches Kleinod. Warum?
Es ist ein Museum, dessen Inhalte die Anwohner des Tempels
zusammengetragen haben. So befinden sich im gedämpften Licht dieses alten
großen Holzhauses Gegenstände nebeneinander, die nur deswegen
zusammenpassen, weil die Nachbarn das so fanden: Samurai-Schwerter,
Kapitänsmützen, Stoffe, Geschirr, Buddhafiguren, alte Grammophone, noch
ältere Radios, eine der historisch ältesten Urkunden über Landbesitz; und alte
Fotos von quirligen Märkten, ernst dreinblickenden Mönchen und vor allem
vom großen Brand, der 1968 den Warrorot-Markt verwüstete.
Dieser Markt ist wieder aufgebaut worden, und wenn man bis in die oberste
Etage klettert, findet man jede Menge schöner Textilien, „ethnic fashion“ im
Lanna Stil zu kleinen Preisen. Wer beide Orte am gleichen Tag erleben will, dem
sei geraten, frühmorgens zuerst den Warrorot-Markt zu besuchen, weil die
Temperaturen noch erträglich sind, und danach erst das Gategaram Museum. Es
ist ein Wechsel vom Lärm zur Stille.
School for Life, 28. /29. Mai 2014
Unter dem Vordach des Farmhauses, 19:00 Uhr: Das Mädchen Namsom (13),
das Mädchen Yupa (15), der Junge Cob (17) und das Mädchen Ammy (12)
kommen und wollen etwas. Ich denke mir schon, was sie wollen, tue aber so, als
hätte ich keine Ahnung. Sie merken, dass sie das, was sie wollen, mir auf
Englisch klar machen sollen. Und los geht’s mit einem erst stotternden, dann
aber Fahrt aufnehmenden Dialog. Sie wollen an kostenlosen Wochenendkursen
in Joy’s House teilnehmen, in denen Englisch, Chinesisch, Deutsch, Thai
Boxing, Thai Dance, Backen, Kochen und House Keeping unterrichtet wird. Ein
volles Programm an jedem Wochenende, das ganze Schuljahr über. Ihre Lehrer
dort sind nicht nur Erwachsene, sondern auch Alumni der School for Life aus
der ersten und zweiten Generation.
Namsom, Yupa, Cob und Ammy bitten mich um Zustimmung und um ein
Schreiben an ihre Familienlehrer mit der Bitte, den vier Lernwilligen die
Teilnahme zu erlauben. Ich finde das Angebot sehr gut, setze ein Schreiben an
die Familienlehrer N. Boy, Oun-J-Rak und Sai-Ya-Rak auf und bitte höflich um
Zustimmung. Ich lese den Entwurf vor, die Vier verstehen alles und freuen sich.
Die Briefe werden in Umschläge gesteckt. Es ist 19:30 Uhr. Die Vier
entschwinden in die Dunkelheit mit ihren Briefen.
Am nächsten Morgen nach der Fahnenzeremonie erzählen die Vier, sie hätten ja
den Brief verstanden, aber die Familienlehrer hätten ihre Mühe damit gehabt,
weil sie nicht so gut Englisch könnten. Die Vier strahlen – denn es kommt nicht
dauernd vor, dass Schüler ihren Lehrern glasklar überlegen sind.
School for Life, 30. Mai 2014
Um 8:00 Uhr morgens versammeln sich die Kinder und Jugendlichen der School
for Life zur morgendlichen Zeremonie. Es wird gesungen und meditiert, die
thailändische Fahne hochgezogen und die Nationalhymne in schätzungsweise
sieben verschiedenen Tonarten angestimmt. Die Kinder sind in ihren Trachten
erschienen, ein farbenprächtiges Bild.
Mittags habe ich alle Neuen ins Farmhaus eingeladen, fast alle, denn zwei neue
Kindergartenkinder schlafen gerade. Ich erzähle ihnen die Gründungsgeschichte
der School for Life, sage, dass unser oberstes Ziel sei, sie glücklich zu machen,
dass wir eine große Familie seien, in der sie sich zu Hause fühlen können.
Außerdem würden wir langweiligen Unterricht in Klassenzimmern nicht so
gern haben, sondern lieber Fische züchten, Gemüse anbauen, ein Haus
reparieren oder ein Fest feiern. Klar: Mathe, Englisch, Thai, Naturwissenschaft
und was es sonst noch so im Lehrplan gibt, würden sie auch lernen, aber nicht so
stur wie in manchen Schulen.
Alle Kinder kommen aus extremen Verhältnissen. Alle sind Angehörige
ethnischer Minderheiten, und weil sie sich alle sehr freundlich vorgestellt haben,
will ich das mit den 21 versammelten neuen Mädchen und Jungen auch tun:
Von den Karen kommen die Mädchen Daofa (13), Nattamon (13), Wisarut (13),
Satida (13), Vareerat (13) und der Junge Apirat (12). Zum Volk der Akha
gehören die Mädchen Orawee (10) und Supaphan (11) sowie die Jungen
Sompong (8), Anan (10), Nitikran (13), Surapong (15), Nopadon (14) und Anon
(7). Zu den Lisu zählen das Mädchen Chureeporn (11) und die Jungen Pichai (9)
und Chatee (16). Drei sind Lahu: das Mädchen Supaporn (15) sowie die Jungen
Pongsaton (12) und Anothai (10). Ein Junge, Anupat (8), ist ein Hmong. Thais?
Diesmal sind keine dabei.
Und von inzwischen aufgewachten Kindergartenkindern ist das Mädchen
Supapon (5) eine Akha und der Junge Tanit (5) ein Lahu.
Viele neue Geschichten. Viele Fragen und Hoffnungen. Eine kleine neue
Generation der School for Life macht sich auf den Weg.