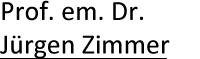Nicht das Rad neu erfinden
Der Bildungsanspruch des Situationsansatzes reicht weiter,
als PISA es verlangt
Institut für den Situationsansatz, Berlin; Anruf der Kollegin Marie-Theres Albert von der TU Cottbus: Die Geschichte mit PISA sei doch richtig hervorragend. Wieso denn? Weil die, nein: die Antwort auf PISA der Situationsansatz sei, und das nicht erst seit gestern, sondern seit dreißig Jahren. Er sei das einzige Konzept weit und breit, das einen wirklichkeitsbezogenen Bildungsanspruch ernst nähme und die Lösung von realen Problemstellungen in realen Situationen favorisiere. Er sei mehr als PISA. Und er sei auch das beste Verfahren, um beispielsweise durch dauerhaftes Auswendiglernen vom selbstständigen Denken entwöhnte Ingenieursstudenten in Cottbus angemessen auf ihre beruflichen Anforderungen vorzubereiten.
Ein paar Wochen später in Berlin-Steinstücken; auf dem Schreibtisch, von der GEW verschickt, eine Stellungnahme der Vereinigung hessischer Unternehmerverbände (VhU): Der Situationsansatz vernachlässige Bildungsaspekte, die vorwiegend im Umgang mit Sacherfahrungen entwickelt würden.
Also was nun? Die VhU schreibt Unsinn, sofern sie den Situationsansatz als Konzept meint. Die VhU schreibt Bedenkenswertes, sofern sie dessen Abhalfterung in Teilen der Ausbildung und Praxis in den Blick nimmt. Die vier Quintessenzen der folgenden Abschnitte lauten: (1) Der Situationsansatz ist wirksam. (2) Der Situationsansatz hält den Bildungsanspruch hoch. (3) Teile der Ausbildung und der durch sie mitgeprägten Praxis sind ein Problem. (4) Anreize sind nötig, um mehr Qualität zu erzielen.
1.Nachhaltige Wirksamkeit
Im Situationsansatz geht es im weitesten Sinn um die Begründung und Gestaltung von Bildungsprozessen. Dreimal wurde er bisher evaluiert:
Die in der ersten Hälfte der neunziger Jahre unternommene Spurensicherung der westdeutschen Kindergartenreform, repräsentiert durch das in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre durchgeführte bundesweite Erprobungsprogramm, orientierte sich an einer pragmatistischen Evaluationsstrategie. Untersucht wurden vor allem Kindergärten, die am Erprobungsprogramm teilgenommen hatten, ihr Umfeld, die anhaltende oder nur passagere Wirkung des Erprobungsprogramms, die Brüche bei der Implementation seiner Ergebnisse. Drei Gruppen gewannen Konturen: die exzellent arbeitende Einrichtung, in der der Situationsansatz ideenreich praktiziert und auf neue Lebensverhältnisse hin interpretiert wird; eine Gruppe, in der Elemente des Situationsansatzes sichtbar werden; eine dritte Gruppe mit unterdurchschnittlichem, beschäftigungspädagogischem Zuschnitt (Zimmer u.a.1997).
Eine aufwendige externe, empirische und summative Evaluation erfuhr der Situationsansatz durch eine Forschungsgruppe der Universität Landau gegen Ende der Laufzeit des Modellprojektes „Kindersituationen“ 1996 und 1997 (Wolf u.a. 1998, Wolf u.a.1999). Verglichen wurden Modelleinrichtungen mit Einrichtungen des erweiterten Kreises (Kindertagesstätten, die am Rande des Modellversuchs mitbetreut wurden) und Kontrolleinrichtungen (deren Teams angaben, nicht nach dem Situationsansatz zu arbeiten). Im Mittelpunkt der Untersuchung standen Auswirkungen von Interventionen im Rahmen des Situationsansatzes auf Erzieherinnen, vor allem aber auf Kinder. Es sei kein Zweifel, heißt es in einer ersten Darstellung der Ergebnisse, dass sich die pädagogische Arbeit nach dem Situationsansatz auch schon nach relativ kurzer Zeit bemerkbar mache (Wolf u.a. 1998, S.289): Das Kind, das eigenaktiv, selbständig und konsequent den einmal eingeschlagenen Weg verfolge, das Kind, das aktiv und auf anregende Weise seine Themen vorantreibe, das Kind, das Konflikte austrage, sei in Einrichtungen, die nach dem Situationsansatz arbeiten, deutlich stärker vertreten als in Einrichtungen, die das nicht tun.
An anderer Stelle heißt es dazu: „Vor allem in folgenden inhaltlichen Bereichen zeigen sich in den Modelleinrichtungen höhere Werte:
- Gewährung von Freiraum für Kinder (Erzieherin)
- Entscheidungsfreiheit und Eigenständigkeit (Kindergruppe)
- Das selbst entscheidende und bei der Sache bleibende Kind (Kind)
- Kind handelt nicht allein auf Anweisung der Erzieherin (Kind)
- Kindgerechte Anregung (Erzieherin)
- Das aktive, anregende Kind (Kind)
- Kind beschäftigt sich lange mit einem selbstgewählten Thema (Kind)
- Konfliktaustragung und Unabhängigkeit von Erwachsenen
(Kindergruppe)
- Kind, das Konflikte austrägt (Kind)
- Auseinandersetzung mit Regeln und Normen (Kind und Erzieherin)
- Räumlich-materiale Möglichkeiten (Tageseinrichtung)
- Bereitstellung von ‚echten‘ Gebrauchsgegenständen (Tageseinrichtung)
- Bereitstellung von wertlosen, zweckfreien Materialien (Tageseinrichtung)
(Wolf u.a. 1999, S.271).
Vier Jahre danach – 2000 bis 2001 – gab es eine Fortschreibung der Datenanalyse, mithin eine weitere Evaluation durch die Landauer Forscher. Ihre Vermutung war, dass sich aus verschiedensten Gründen – unter anderem wegen einer hohen Fluktuation des Personals in den einbezogenen Einrichtungen – die damaligen Effekte verflüchtigt hätten. „Wir gingen“, schreiben Wolf, Hippchen und Stuck, „also von der Hypothese einer fast vollkommenen Nivellierung nach vier Jahren… aus“ (Wolf u.a. 2001, S.431). Unerwarteterweise zeigten sich aber auch nach diesem Zeitraum deutliche Effekte im Sinne der früheren Ergebnisse.
Und PISA? Wenn im Zentrum der Studie weniger die Frage steht, wie gut Jugendliche schulische Lernstoffe beherrschen, wenn es vielmehr um die Fähigkeit geht, „Kenntnisse und Fertigkeiten zur Bewältigung realitätsnaher Herausforderungen einzusetzen“ (OECD 2001, S.1), dann kann man Kindergärten wie Grundschulen getrost raten, unter Anlegung hoher Qualitätsstandards den Situationsansatz zu praktizieren und weiterzuentwickeln. Künftige Sekundarschüler würden, so vorbereitet, eine weitere PISA-Untersuchung vermutlich deutlich besser überstehen, selbst wenn es bei einer solchen Untersuchung immer noch nicht um Problemlösungen in realen, sondern in erdachten Situationen gehen sollte.
2.Bildungsanspruch
Der Situationsansatz, der sich nicht nur auf den Bereich einer Erziehung in früher Kindheit bezieht, ist ideengeschichtlich durch die Bildungs- und Curriculumtheorie geprägt, wie sie Shaul B. Robinsohn und seine Gruppe am Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Auseinandersetzung mit der fächerbezogenen Didaktik entwickelt haben. Bildung ist nach Robinsohn Ausstattung zum ‚richtigen‘ und ‚wirksamen‘ Verhalten in der Welt. ‚Verhalten‘ ist im umfassenden Sinn anthropologisch, nicht behavioristisch gemeint. Es ging Robinsohn um eine gewinnende Lebenshaltung, um die Möglichkeit, neue und wechselnde Horizonte der physischen und geistigen Welt aufzunehmen, zu Allianzen fähig zu sein, ohne Loyalitäten aufzugeben, sich neuen Problemen im Vertrauen auf neue Lösungen zu stellen. Bildung hat die Ambivalenz der Bedürfnisse nach Kontinuität und Sicherheit einerseits und nach Offenheit, Entdeckung und Produktivität andererseits auszuhalten, ist also auf Überlieferung angewiesen wie auch auf Zukunft hin zu formulieren.
Menschen für ‚richtiges‘ Verhalten in der Welt auszurüsten, bedeutet den Versuch, global concerns auch als local concerns zu verstehen und deren Wechselverhältnis zu sehen. Situationsanalysen innerhalb des Robinsohn’schen Strukturkonzeptes der Curriculumentwicklung wie auch innerhalb des Situationsansatzes sind, fundiert angelegt, nicht nur auf Situationen hier und jetzt, sondern immer auch auf die in ihnen enthaltene und sie mit konstituierende Vergangenheit und die auf sie einwirkenden gesellschaftlichen Kräfte bezogen. In der Bestimmung von qualifikationsrelevanten Sachverhalten und der Formulierung von Qualifikationen findet der Entwurf des Zukünftigen seinen Ausdruck; zum ‚richtigen‘ und ‚wirksamen‘ Verhalten in der Welt gehört die Fähigkeit, in Situationen nicht nur zu bestehen, sondern sie auch zu gestalten.
Der hier gemeinte Bildungsanspruch legt nahe, sich Zugänge zu situationsspezifischem, -transzendierendem und generalisierendem Wissen zu verschaffen, die möglichst unmittelbar zur Erkenntnis führen und nicht Umwege einschlagen müssen, die durch die scheinbar immanente ‚Logik‘ einer der didaktischen Reduktion unterworfenen Fachdisziplin bestimmt werden (Delphi-Befragung 1996/1998). Diese von Fachdidaktikern behauptete ‚Logik‘ erweist sich bei näherem Hinsehen in Teilen als Konvention des mainstream darüber, welche Wissensbestände in welcher Anordnung als bedeutsam eingeschätzt werden, wie innerhalb einer sequentiellen organisation des Wissenserwerbs das Davor und Danach anzuordnen, wie Wissen zu hierarchisieren sei. Untersucht man jedoch komplexe Ausschnitte sozio-kultureller, technologischer oder ökonomischer Wirklichkeit und identifiziert in ihnen qualifikationsrelevante Sachverhalte und damit auch Anforderungen an Wissen, machen diese Anforderungen vor disziplinären Grenzen nicht halt, sondern überspringen sie vielfach, verlangen nach interdisziplinären Amalgamen, nach einer Fokussierung wissenschaftlichen Wissens unterschiedlicher Provenienz auf Schlüsselprobleme, zu deren Aufklärung und Lösung dieses Wissen beitragen soll (Damerow u.a. 1974). Diese Wirklichkeit straft den fachdidaktischen Tunnelblick ständig Lügen. Die akademischen Wissensbestände sind von hohem Nutzen, nur sind sie im Hinblick auf ein Lernen in komplexen Realsituationen vielfach falsch organisiert und versperren Chancen des Transfers solchen Wissens. Ein Curriculum, das sich an generativen Themen orientiert und von dort her strukturiert, ‚plündert‘ wissenschaftliche Wissensbestände und bezieht sie in geeignetem Zueinander auf reale Situationen und Probleme. Die Quellen akademischen Wissens reichen dabei nicht aus; weitere Quellen – die Vorerfahrung von Menschen, die Erkenntnischancen intuitiven und hermeneutischen Denkens, der künstlerische Zugang – spielen eine bedeutsame Rolle.
Voneinander abgegrenzte fachdidaktische Strukturgitter können sich wie Erkenntnis- und Handlungsbarrieren zwischen Lernende und Situation schieben. Wird der Erkenntnisprozess hingegen durch Anforderungen der Realität provoziert, wird deutlicher, welches Wissen, welche Kompetenzen hier förderlich sind. Dieser curriculumtheoretische Zugang wirkt der historischen Spaltung des Bildungskanons in Humaniora und Realia entgegen, der Fraktionierung des Lernens in atomisierte Bestandteile von Stoffkatalogen. Allgemeinbildung und Spezialbildung geraten in ein neues Verhältnis: Allgemeinbildung nicht als Summe des Spezialwissens, sondern im Sinne von Hellmut Becker als Weltverständnis und allgemeines Problemlösungswissen; Spezialbildung als Kompetenz zur Lösung spezifischer, Kontextgebundener Schlüsselprobleme. Im Hinblick auf Wissensbestände aus dem Bereich der Realia ist wichtig, auf den historischen Prozess des kollektiven Vergessens sozialer Kontexte mit eben der Rekonstruktion dieser Kontexte zu antworten – nichts anderes meint die Verbindung von sozialem und sachbezogenem Lernen. Die Vermittlung einer auf ihre sozialen Kontexte rückbezogenen Mathematik hätte so Lernenden die systematische Chance zu bieten, nicht-mathematische Voraussetzungen und folgen mathematischer Operationen aufzuklären – dazu gehört beispielsweise das Verständnis für Quantifizierungsprozesse auf der Grundlage nicht-mathematischer Wertsetzungen, einschließlich der retro-analytischen Entschlüsselung solcher Setzungen (Damerow u.a. 1974, S.104ff).
Diese Curriculumtheorie stieß zur Zeit ihrer Entstehung, dies konnte nicht überraschen, auf den Widerstand eines fachdidaktischen Kartells, dessen Vertreter sich neu hätten legitimieren müssen. Gleichwohl entwickelten sich korrespondierend zum Situationsansatz im Kindergarten auch schulische Versuche des binnendifferenzierten, fächerübergreifenden, projektorientierten, auf Schlüsselprobleme bezogenen Unterrichts (Duncker/Popp 1997, Frey 1982, Klafki 1996 und 1998, Münzinger/Klafki 1995). Es ist allerdings ein Unterschied, ob man von einer Realanforderung her denkt und ein darauf bezogenes Problemlösungswissen erschließt oder von einem Fachinhalt her nach illustrierenden und nicht selten ideologisierenden ‚Anwendungen‘ sucht (Keitel 1986). Eine bisher nicht überwundene Schwäche der Fachdidaktik liegt darin, dass sie im Zweifelsfall das Verbindungs seil weit mehr in Richtung Disziplin und weit weniger in Richtung komplexe Realität auswirft. Im Extremfall bedeutet dies ‚akademische‘ Stoffhuberei, während der Situationsansatz die Problemlösungen in Realsituationen ins Zentrum rückt und den jeweiligen Prozess der Erschließung und Aneignung von problemlösendem Wissen mindestens ebenso ernst nimmt wie dessen Inhalte.
Die Kritik fachdidaktischer Verengungen ist nicht gleichzusetzen mit einem Verzicht auf systematisches Lernen und eine sequentielle Anordnung von Lerninhalten. Dort, wo beides im Kontext der Situationen Sinn macht, ist es willkommen. Zudem reklamiert der Situationsansatz keinen Monopolanspruch, sondern verhält sich komplementär zu anderen Lernzugängen, sofern sie seinen normativen Prämissen – zu denen die Postulate von Autonomie, Kompetenz und Solidarität, eine Balance von Eigensinn und Gemeinsinn gehören – nicht widersprechen. Wenn die Ausbildung von Studierenden der Medizin an der Harvard Universität von komplexen Problemsituationen ausgeht und damit den hier skizzierten Weg einschlägt, wird der Wissenserwerb einem komprehensiven Verständnis der Situation von Patienten untergeordnet. Formelles und informell-situatives Lernen geraten in ein systemisches Wechselverhältnis.
Nimmt man Aussagen aus der Delphi-Befragung über Potentiale und Dimensionen der Wissensgesellschaft, dann ergeben sich zahlreiche Übereinstimmungen: Der Erwerb von Kompetenzen zur Erarbeitung von Problemlösungswissen wird als zunehmend relevant eingeschätzt – der Situationsansatz hilft bei der Lokalisierung und Wichtung dieser Probleme, bei der Bereitstellung realistischer Settings und hochdifferenzierter Lernumwelten. Das Lernen wird zunehmend im Wechsel von formaler und situativer Bildung erfolgen. Problemlösungswissen wird wichtiger als reines Fachwissen. von der Kanonisierung des Wissens in einem festen Bildungskanon wird man sich verabschieden müssen – der Situationsansatz setzt hier schon lange auf exemplarische situationen, unter ausdrücklichem Verzicht auf den Versuch einer ‚überzeitlichen‘ und transkulturellen Festschreibung.
Im Bereich des formalen Bildungswesens wird eine Implementation der Ergebnisse des Bildungs-Delphi auf ähnliche Barrieren stoßen wie seinerzeit das - durch das Bildungs-Delphi aktualisierte - Strukturkonzept der Curriculumrevision. Im sozialpädagogischen Milieu der Jugendhilfe ist hingegen mit einem anderen Handikap zu rechnen: Die Ausbildung der Erzieherinnen vermittelt bisher – von rühmlichen Ausnahmen abgesehen – weder eine zureichende Kompetenz für den Situationsansatz insgesamt, noch für seinen spezifischen bildungstheoretischen Anspruch. Zur Vermeidung sozialpädagogisch geprägter Abschottungsprozesse ist es hier notwendig, an einer entsprechenden Professionalisierung der Aus-, Fort- und Weiterbildung weiterzuarbeiten.
Zu den Zielen des Situationsansatzes gehört es, das Verhältnis zwischen raschem gesellschaftlichen Wandel sowie sich entsprechend verändernden Situationen von Kindern in den Blick zu nehmen und auf pädagogische Schlussfolgerungen hin zu diskutieren. Solche Entwicklungen betreffen auch das Tempo des Wandels familialer Strukturen; diese wiederum wirken auf Institutionen der Tagesbetreuung ein – die Druckwellen setzen sich fort. Vergleicht man die situationsbezogenen curricuaren Materialien der siebziger Jahre einschließlich der thematisierten Situationen und Situationsanalysen, so unterscheiden sie sich deutlich von denen des – in den neuen Bundesländern durchgeführten – Projektes „Kindersituationen“: „Das soll einer verstehen! Wie Erwachsene und Kinder mit Veränderungen leben“ heißt eines der Bücher in der „Praxisreihe Situationsansatz“ (Doyé/Lipp-Peetz 1998 b). Zu den erkenntnisleitenden Interessen bei der Analyse von Lebenswelten in den siebziger Jahren gehörte das der Teilhabe von Kindern an der Gestaltung von Situationen – dies in Widerspiegelung des Diskurses über Demokratisierung in jener Zeit. Der Situationsansatz in den achtziger Jahren war unter anderem durch die Reflexion interkultureller Lebenszusammenhänge geprägt. In den neunziger Jahren bildeten die gesellschaftlichen und ökonomischen Umbrüche den Hintergrund von Situationsanalysen – der Prozess des relativen ökonomischen Abstiegs Deutschlands mit dem damit verbundenen Verlust von Arbeitsplätzen, mit der Entwicklung von Patchwork-Lebensläufen und der Notwendigkeit, die Fähigkeit zum micro innovative entrepreneurship als Grundqualifikation zu verstehen und zu lernen, auf die eigenen Füße zu fallen.
Lernen in einer sich verändernden Wirklichkeit enthält für den Situationsansatz die Chance, durch die von und mit Kindern vollzogene Erschließung kindgemäßer, gleichwohl komplexer Realsituationen die von der Kognitionspsychologie immer wieder geforderten hochdifferenzierten Lernumwelten zu schaffen (Dickinson 1994, Morowitz/Singer 1995, Perkins 1987). Hierzu können durchaus auch neue Realitäten wie die Medien zählen
(Papert 1993).
Mitglieder von UNESCOs neuem Think Tank „Learning Without Frontiers“ verweisen darauf, dass der informal learning sector, der zeitlich umfänglicher und qualitativ bedeutsamer sei als der formelle Sektor verfasster Bildungsinstitutionen, auf die Anforderungen des Hyperchange möglicherweise wesentlich flexibler und angemessener reagiere als der formelle Sektor. Dies hänge damit zusammen, dass sich im informellen Sektor ein pädagogisch gleichsam entfesselter Typus des Lernens entfalten könne: Er zeige, zu welchen situationsstrategischen Leistungen menschliches Lernen in der Lage sei. Dies sei auch ein Sachverhalt, der durch Forschungen in den Bereichen der Kognitionswissenschaften, der angewandten Linguistik, der Psychologie, der Neurologie, der Ökologie, Biologie, Sozialanthropologie und Semiotik gut erfasst sei, der aber dem im pädagogisch-institutionellen Setting realisierten Lerntypus widerspreche: „Our current educational solutions, still grounded in the metaphors of yesterday, continue to view learning as a mere preparation for life – with a discrete beginning and end – not as an integral part of life“ (Jain 1997, S.6).
Für den Situationsansatz ist der informelle Sektor des Lernens von hohem Interesse. Die von UNESCO geäußerte These ist ja, dass er die Potenzen menschlichen Lernens besonders herausfordere und entfalten könne. Menschliches Lernen sucht sich seinen Weg auch durch das Drunter und Drüber, legt Handlungsschneisen, speichert Erfahrungen, wertet Irrtümer aus. Erkenntnis- und Lernprozesse in Realsituationen, in open learning communities, lassen sich elaborieren, Möglichkeiten des Transfers unter realistischen Rahmenbedingungen ausloten – ein Lernen in der Unsicherheit, aber auch Herausforderung des offenen Ausgangs ist etwas anderes als die Organisation des Lernens unter artifiziellen Bedingungen und in Parametern der Scheinsicherheit.
Pädagogisch gefördertes Lernen in komplexen Realsituationen bedeutet mithin, Lernchancen innerhalb der Situationen zu erweitern, Zugänge zu situationsspezifischen und –überschreitenden Wissensbeständen zu gewinnen, Risiken abzuwägen, Transfermöglichkeiten zu nutzen, sich über normative Bezugspunkte des Handels zu verständigen. An einem den Situationen angemessenen Verständnis des Lernens muss weitergearbeitet werden, nicht nur im Bereich der frühen Kindheit, sondern auf jenen Stufen des Bildungswesens, auf denen Programm und Setting zunehmend ins Abseits geraten: Viele der gesellschaftlich relevanten Lernprozesse, das hat Ralf Dahrendorf schon vor Jahren bemerkt, werden jenseits der durch Inkompetenzen gekennzeichneten pädagogischen Institutionen organisiert. Hinsichtlich einer Didaktik des Situationsansatzes ist das Verhältnis von Verschulung und Entschuldung, von Komplexität der Wirklichkeit und Komplexitätsreduktion des Lernvorgangs, von Selbstregulation und strukturierender Moderation von Lernprozessen immer wieder neu zu verhandeln.
3. Abdrift der Ausbildung
Wenn ein Berufsstand, von einer lebhaften Brise getrieben, sich positiv fortentwickelt, sollte die Ausbildung mit dieser Entwicklung in Tuchfühlung bleiben, besser: Sie sollte diese Entwicklung unterstützen, mit vorantreiben, ihre Qualität sichern. Ausbildung könnte zum Ferment einer rollenden Reform werden, die andauernde Anstrengung der Qualitätsentwicklung auf sich nehmen.
Driftet die Ausbildung ab vom Entwicklungsgeschehen, gerät sie in eine Flaute, unterliegen die Lehrenden einer stetigen déformation professionelle, kommt ihrem Unterricht der Bezug zu gegenwärtigen beruflichen Anforderungen abhanden. Die Karawane zieht dann ohne die Ausbildung weiter.
Anfang der siebziger Jahre, nach den two decades of non-reform in West German education (Robinsohn), entwickelte sich - ähnlich einer großen antarktischen Eisscholle, die ins wärmere Wasser gerät - ein Riss zwischen dem Reformgeschehen in der Praxis und einer eher stagnierenden Ausbildung. Beide, Praxis und Ausbildung drifteten langsam auseinander. Der Kindergarten hatte die Botschaften von Freire, Illich, Bernfeld und Robinsohn besser verstanden als die Schule. Der in der ersten Hälfte der siebziger Jahre entwickelte und danach bundesweit erprobte und akzeptierte Situationsansatz stellt eine zugleich entschulte wie intensive Lernlandschaft dar.
Das Dilemma der Ausbildung zeichnete sich curricular und strukturell ab. Während die Schlüsselsituationen von Kindern 'draußen' von einigen tausend Erzieherinnen - durch Wissenschaftler unterstützt - analysiert und pädagogisch beantwortet wurden, bewegten sich 'drinnen' die Fachinhalte und Fächerstrukturen nur in bescheidenem Maße. Es war nicht so, dass sich - im Freire'schen Sinne - generative Themen von 'draußen' als strukturierende Elemente des Curriculum 'drinnen' durchgesetzt hätten. Fanden sie überhaupt einen Widerhall, hatten sie sich der Fächerstruktur unterzuordnen.
Ein für die Ausbildung verhängnisvoller Fehler jener Jahre lag in der Verengung staatlicher Modellversuchspolitik auf Praxiseinrichtungen, die nicht im Zusammenhang mit ihrem systemischen Umfeld gesehen wurden. So blieb undeutlich, dass sich ein innovationsfreudiger Kindergarten in einem solchen Umfeld befindet, eines, das auf ihn verstärkt einwirkt, wenn die Laufzeit des in stützenden Modellversuchs beendet ist und keine auf Nachhaltigkeit angelegte Implementationsphase folgt. Besonders deutlich wurde dies mit Ablauf des Erprobungsprogramms Ende der siebziger Jahre, jenem dreijährigen Großprojekt, das der Prüfung unterschiedlicher curricularer Materialien diente und zur konsensuellen Verständigung über den Situationsansatz und seine Varianten führte. Mit Ende des Programms fielen regionale Projektgruppen und Moderatorenstellen in neun Bundesländern weg. Konferenzen und Arbeitstreffen wurden nicht fortgesetzt. Viele der von den Entwicklungen beflügelten Erzieherinnen fanden sich in einem Umfeld wieder, das sich - von wenigen Bundesländern und Trägern abgesehen - reformneutral bis vorreformatorisch verhielt. Oft fanden diese Erzieherinnen, dies zeigte eine spätere Evaluationsstudie - niemanden, der sie anerkannt oder ermutigt hätte.
In einem solchen Verständnis von Bildungspolitik sind Modellversuche nicht Akzente einer systemisch angelegten rollenden Reform, sondern thematisch und institutionell engdimensionierte temporäre Akte. Hören sie auf, müsste eigentlich die unabhängig von Modellversuchen existierende Infrastruktur - die Aus- und Fortbildung, die Träger und die Jugendämter - die Stafette übernehmen und aus temporären Entwicklungsanstrengungen permanente machen. Was aber, wenn diese anderen Teilsysteme zuvor gar nicht oder nur in Ansätzen an solchen Entwicklungen beteiligt waren? Immerhin: In einigen wenigen Landstrichen waren sie angekoppelt, dort fuhren sie wie auch die Praxiseinrichtungen unter Dampf weiter; es waren die engagierten Praxiseinrichtungen, die mit engagierten Trägern, engagierten Fachberatern, engagierten Aus- und Fortbildungseinrichtungen und engagierten Jugendämtern zusammenarbeiten konnten. In vielen anderen Landstrichen breiteten sich langsam wieder weiße Flecken aus, sie wurden größer, je länger Modellversuche und Erprobungsprogramm zurücklagen.
Gegenwärtig kann man dieses Déjà-vu in den neuen Bundesländern erleben. Das groß angelegte Projekt "Kindersituationen", das den Situationsansatz drei Jahre lang in all diesen Ländern (samt dem Ostteil Berlins) adaptierte und weiterentwickelte, das erfolgreich einer externen empirischen Evaluation unterzogen wurde, hat nur zu vereinzelten Implementationsanstrengungen auf breiter Ebene geführt.
Die Kindergartenreform im Westen hatte übrigens nicht nur 'intrinsische' Motive, war also nicht nur dem pädagogischen Gewissen verpflichtet, sondern wurde auch durch 'extrinsische' Motive veranlasst: Die lagen in dem vom Deutschen Bildungsrat losgetretenen Streit um die Fünfjährigen, der letztendlich wie das Hornberger Schießen ausging. Kaum war er vorüber, ebbte der Eifer extrinsisch motivierter Träger des Reformgeschehens ab.
Ein weiteres Moment beförderte die Abdrift: die kulturelle Distanz zwischen Jugendhilfe und Schule, zwischen Sozial- und Kultusministerien. Fachschulen und Kindergärten unterliegen, was Ressortzuständigkeiten anbelangt, in den meisten Fällen dem Einfluss unterschiedlicher Philosophien. Das Verhalten der Jugendhilfe ist dabei - historisch gesehen - ambivalent. Einerseits hat sie die Chance, moderne Lernsettings ohne verschulte Strukturen anzubieten. Andererseits blickt sie, was ihren eigenen Institutionalisierungsgrad anbelangt, neidvoll auf das streng verfasste Bildungswesen. Das auf weitere Institutionalisierung gerichtete Interesse der Jugendhilfe läuft ihrem pädagogischen 'Freiheitsanspruch' zuwider. Mithin setzt sie sich dem verschulten und verdinglichten Typus Fachschule wenig Widerstand entgegen.
Die Fachschule konnte sich so zu einem Zwitter entwickeln, der ein sozialpädagogisches Klientel jenseits des Schulwesens ausbildet, aber diesseits, innerhalb rigider Strukturen, angesiedelt ist. Die Sisyphusarbeit eines gutwilligen Schulkollegiums besteht darin, dass es, an den weitgehend falschen Ort gefesselt, für ein wesentlich freieres Gelände ausbilden soll. Um das wirklich zu können, müsste es erstmal zum Entfesselungskünstler werden.
Paradox ist das Curriculum vieler Fachschulen. Es vernachlässigt den Bildungsanspruch des Kindergartens und arbeitet damit einer 'bildungsfernen' Jugendhilfe zu. In der Philosophie der Jugendhilfe geht es primär nicht um Bildungsprozesse. In den Settings der Jugendhilfe könnte es aber um Bildung in komplexen Realsituationen gehen, um mehr, um besser anwendbare und transferierbare, nicht um weniger Bildung. Anstatt der Bildungsferne der Jugendhilfe einen klaren Bildungsanspruch entgegenzusetzen, folgen nicht wenige Ausbildungseinrichtungen den Selbstbeschränkungen der Jugendhilfe. Ein Kindergarten ist keine Schule: richtig. Das muss aber doch nicht heißen, vage Formen sozialen Lernens oder unterfordernde Beschäftigungsangebote als ausreichendes Leistungsniveau zu nehmen. Fachschulen stellen hier durch die unzureichende Vermittlung lernbereichsdidaktischer, auf den Situationsansatz bezogener Kompetenzen ihr schulpädagogisches Licht unter den Scheffel. Sie vermitteln in einer keinesfalls befriedigenden Weise, wie man - in Abwandlung des nach wie vor wichtigen curriculumtheoretischen Ansatzes von Jerome Bruner ("structures of disciplines") - zwar nicht wissenschaftspropädeutisch (Wissenschaft ist kein Selbstzweck) im Kindergarten arbeitet, aber doch 'wissenschaftliches' Wissen auf situative Zusammenhänge beziehen kann: nicht Fachdidaktik, sondern lernbereichsdidaktisch vertiefte Situationsdidaktik. Der weit gehende Verzicht darauf bedeutet, den Bildungsanspruch des Kindergartens und des Situationsansatzes abzuhalftern.
Ein weiteres retardierendes Moment, mit dem Fachschulen sich auseinander zu setzen haben, liegt in dem formal viel zu niedrigen Eingangs- und Ausgangsniveau der Ausbildung. Dass das Erfinderland des Kindergartens nunmehr mit Österreich das europäische Schlusslicht darstellt, ist nicht nur für Industrie-, sondern auch für Schwellenländer ein weitgehendes Unikum. Für die meisten asiatischen Länder beispielsweise ist ein an nordamerikanischen oder britischen Standards orientierter Universitätsabschluss Voraussetzung für die Arbeit in einer qualifizierten Einrichtung.
Zu Zeiten der westdeutschen Kindergartenreform fiel dieses Manko deshalb nicht auf, weil der partizipatorische Charakter der Reformentwicklungen bei allen beteiligten Kräften - einschließlich der Kinderpflegerinnen - einen erheblichen Professionalisierungsschub bewirkte. Spätestens in den achtziger Jahren aber wurde sichtbar, dass die Karrierehoffnungen qualifizierter Erzieherinnen ins Leere führten, dass sie Gefahr liefen, einem cooling out zu unterliegen, falls sie nicht den Beruf wechselten. Hinzu kam, dass andere attraktive Berufe inzwischen von Frauen erobert wurden, so dass die zur beruflichen Stagnation verurteilten Erzieherinnen der Karriere dieser Frauen nur hinterherblicken konnten. Wer heute den Beruf der Erzieherin wählt, muss - pointiert ausgedrückt - entweder besessen oder in Verlegenheit sein oder eine defensiv orientierte Biographie mitbringen: Man möchte dann nicht ins feindliche Leben hinaus, sondern im geborgenen Rahmen die eigene Kindheit zurückgewinnen.
Blickt man in die Geschichte des Berufs zurück, gab es die Schnittstellen Kindergärtnerin/Jugendleiterin bzw. mittlere Bildung/Abitur. Eine der impliziten Thesen der von Tilmann Netz vorgelegten empirischen und zugleich sozio-historischen Studie über die Ausbildung von Erzieherinnen ist die, dass die Abiturschwelle der Tendenz nach den Unterschied zwischen einer eher regressiven, schonraum- und behütungsorientierten Berufseinstellung und einem eher den Bildungsanspruch des Kindergartens betonenden beruflichen Selbstverständnis markiert.
Ein entscheidendes, mitzuverantwortendes Manko der Fachschulen - von rühmlichen Ausnahmen abgesehen - liegt in ihrem Verzicht auf eine output-orientierte, auf berufliche Verwendungssituationen bezogene Curriculumentwicklung. Wären die Fachschulen dem Robinsohn'schen Strukturkonzept der Curriculumrevision gefolgt, hätten sie ihre Curriculumentwicklung an gesellschaftlichen und familialen Veränderungen, an den dem Wandel unterliegenden beruflichen Anforderungen von Erzieherinnen orientiert, wären sie nicht ins Abseits geraten; kurzum: sie hätten nicht nur Anschluss behalten, sondern in Würdigung dieser Entwicklungen neue berufliche Profile mitdefinieren können. Statt dessen hat das schon zitierte fachdidaktische Kartell - quer über die verschiedenen Schularten - die Robinsohn'sche Herausforderung ausgesessen. Damit aber war die Weiche für die Ausbildung Richtung Abstellgleis gestellt. In den Untersuchungsergebnissen von Netz spiegelt sich diese Enttäuschung wieder: "Je weniger die individuelle Disposition der Lernenden berücksichtigt wurde, weil die einzelnen Unterrichtsfächer nach Regeln der Fachdidaktiken unterrichtet wurden, und zwar von Lehrkräften, die sich mit der Pädagogik des Kindergartens wenig identifizierten, die in der Reformphase die Idee vom neuen Kindergarten nicht zu ihrer eigenen machten, um so mehr wurde die Ausbildung nur als Zugangsvoraussetzung erlebt, nicht aber als eine Phase, in der grundlegende Kompetenzen im Rahmen der beruflichen Sozialisation erworben werden" (Netz 1998, S.353).
Fazit: Nach den Innovationsschüben der siebziger Jahre erlebten wir in den achtziger - und im Westen auch in den neunziger - Jahren - eine Abbremsbewegung. Zwar gab es in einigen Bundesländern - Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen - deutliche Bemühungen, das Ausbildungsdefizit in Sachen Reformstandards durch Fortbildungsveranstaltungen zu kompensieren, und es gab und gibt auch einzelne Fachschulen, die mit langem Atem diese Standards in bemerkenswerter Weise hochhalten und fortentwickeln, aber es gab keine konzertierte, bundesweite Aktion. Eher waren es positive Infektionsketten: Ein von diesen Standards überzeugter Dozent bildete Studierende aus, die in reformbewusste Praxiseinrichtungen gerieten, später ihren eigenen Kindergarten leiteten und wiederum Praktikantinnen förderten...
Die beiden Subsysteme Ausbildung und Praxiseinrichtungen drifteten gleichwohl auseinander wie aufgebrochene Packeisflächen im Polarmeer. Die Ausbildung verlor zunehmend den Kontakt zur bewegten Praxis, die bewegte Praxis wiederum verlor an Schubkraft. Die Fortbildung hatte mitunter mehr Chancen, dranzubleiben, zumindest dann, wenn ihre Dozenten sich nicht ihrerseits allzu sehr an den Bezugswissenschaften festklammerten - nach dem Motto: ich bin Psychologe und nur auf Leitungskonflikte eingestellt. Das Reformprofil der siebziger franste in den achtziger und neunziger Jahren aus. Fähnlein der sieben Aufrechten hielten durch, daneben Resignation, Vergesslichkeit und der Tagungsverbalismus einiger Experten mit dem Bemühen, das Rad neu zu erfinden. Nicht nötig. Es geht lediglich darum, versäumte Lektionen aufzuarbeiten.
4. Zwei Dutzend Vorschläge
Ausbildung als Ernstfall: In Lausanne gibt es eine Hotelfachschule, die in ihre Ausbildung solche Ernstfälle einbaut. Sie ermuntert Hoteliers der Region, der Schule Probleme mitzuteilen und Studenten zur Problemlösung anzufordern. So mag dann den Studenten Anton Grübel die Aufgabe treffen, in kürzester Zeit in der Lobby eines Hotels im Berner Oberland ein drei Meter langes Seewasseraquarium entwerfen und so installieren zu lassen, dass die Fische mehr als nur drei Tage glücklich bleiben. Ob Grübel zuvor etwas von Fischen und Aquarien verstehen muss? Nein. Seine Aufgabe ist es, dieses Wissen zu mobilisieren, zu delegieren, die Problemlösung zu managen und den Erfolg zu gewährleisten. Nicht die Darstellung von Problemen zählt, sondern die Präsentation verlässlicher Lösungen ohne unnötigen Zeitverlust. Einen deutlichen Schuss dieses Arbeitsstils kann man sozialpädagogischer Ausbildung nur wünschen.
Lernen in provozierenden, das Problemlösungsverhalten herausfordernden Settings: Das wäre, nein: das ist die hohe Kunst der Ausbildung. Erfahrungswissen und wissenschaftliches Wissen fließen zusammen. Am Ende bricht das Seewasseraquarium weder unter seinem Eigendruck zusammen, noch verwandelt sich das Wasser in trübe Brühe, noch treiben Fische mit dem Bauch nach oben, noch ziehen sich die Arbeiten in die Länge, noch werden Gäste mehr als minimal gestört.
Wie aber solche Settings schaffen? Wohin das Netz weiter auswerfen? Wie die Ausbildung neu denken? Hier kommen 24 Vorschläge. Sie zielen darauf, das immer wieder stagnierende Gesamtsystem - Praxiseinrichtungen, Schulen und so weiter - durch halbwegs intrinsische Motivationen in eine dauerhafte, der Qualitätsentwicklung, -sicherung und -verbreitung dienende Bewegung zu versetzen: Dies könnte durch Einführung eines sozial verträglich gestalteten Wettbewerbsmodells versucht werden. Ein solches Modell besteht im Grundsatz aus drei Komponenten: erstens aus der Entwicklung von Qualitätsstandards für alle Teilsysteme; zweitens aus einer Verbindung von interner und externer Evaluation in allen Teilsystemen (nicht nur der Praxiseinrichtungen!); drittens in der Schaffung von Anreizen. Ziel ist die Einrichtung einer dauerhaften Reforminfrastruktur unter Einbezug und Dynamisierung existierender Institutionen.
Curriculum
1. Die Unterscheidung in Aus-, Fort- und Weiterbildung entfällt. Aus-, Fort- und Weiterbildung werden konzeptionell und curricular integriert und als lifelong learning-Konzept von Ausbildung, als sequentielle berufliche Professionalisierung und Differenzierung angelegt.
2. Die Ausbildung wird in Modulen mittlerer Reichweite organisiert. Die Module orientieren sich im Wesentlichen an beruflichen Verwendungssituationen und deren qualifikatorischen Anforderungen. Module bestehen aus mehreren Curriculum-Elementen.
3. Aufgabe der verantwortlichen Politik ist es, die allgemeinen Ziele und thematischen Bereiche zu benennen, die durch Module abgedeckt werden sollen. Für die Entwicklung von Modulen sollen Relevanz-, aber auch Gütekriterien vorgegeben werden.
Dieser politische Entscheidungsprozess kann durch die Arbeit von Sachverständigen vorbereitet werden, die, auf Situationsanalysen gestützt, begründete Annahmen über die Art und Entwicklung von beruflichen Verwendungssituationen treffen. Da die Entwicklung einer Struktur des Bildungskanons als Prozess anzulegen ist, sind fortlaufende Korrekturen und Anpassungen möglich.
Soll dieser Entwicklungsprozess professionell durchgeführt werden, muss schulpädagogische und didaktische mit externer, d.h. situationsanalytischer und berufsfeldbezogener Kompetenz zusammenkommen.
4. Monopolähnliche Strukturen auf Seiten der Anbieter von Ausbildung werden aufgelockert. Neuen Entwicklern und Anbietern von Modulen wird der Eintritt in den Professionalisierungsmarkt erleichtert.
Zur Entwicklung von Modulen werden - unter Vorgabe von Relevanz- und Gütekriterien - fachlich geeignete unterschiedliche Anbieter zugelassen. Sie unterziehen sich wie bisherige Anbieter auch einer an Qualitätsstandards orientierten externen, im Dialog mit den Betroffenen erarbeiteten Evaluation. Der Wettbewerb zwischen akkreditierten Modul-Anbietern wird gefördert (leistungsbezogene Mittelzuweisung, ranking). Institutionen mit speziellen Kompetenzen können diese in die Modul-Entwicklung einbringen. Sofern Modul-Entwicklungen nicht öffentlich gefördert, sondern privatwirtschaftlich vorfinanziert werden, können sie im Wege der Lizenzvergabe (franchise) Professionalisierungseinrichtungen angeboten werden. Eine modulentwickelnde Institution kann entsprechende Professionalisierungsprozesse selbst übernehmen.
5. Zu den Aufgaben der verantwortlichen Politik gehört die Festlegung, welche Module zum Fundamentum des Berufs der Erzieherin gehören, und welche Module im Wahlpflicht- oder Wahlbereich bedarfsgerechte und berufsfeldspezifische Vertiefungen und Differenzierungen bzw. neue berufliche Kombinationen ermöglichen.
Das Modul-System verhindert horizontale und vertikale Abschottungen. Erzieherinnen können ihre berufliche Entwicklung stärker selbst steuern und abwechslungs- und perspektivenreicher gestalten.
Das Modul-System verhält sich wegen seiner von Nutzern mitbestimmbaren Flexibilität gegenüber Biographien insbesondere von Frauen freundlicher als starre schulische Vorgaben. Praxiseinrichtungen können sich Module holen und Anbieter über den Wettbewerb veranlassen, in Form einer teambezogenen Professionalisierung vor Ort tätig zu werden.
Man kann sich auch Module aus benachbarten Ausbildungsgängen holen und Perspektivenwechsel oder ungewöhnliche berufliche Kombinationen anzielen. Zur Festlegung von Qualitätsanforderungen gehört die politische Entscheidung, welche Akkumulation oder Kombination von Modulen welche Zu- und Ausgänge ermöglicht.
Das Modul-System setzt auf qualitätsfördernden Wettbewerb im Rahmen öffentlicher Verantwortung, öffentlicher Qualitätskontrolle und gemeinnütziger Zwecksetzung. Es ist nicht gleich bedeutend mit Privatisierung.
6. Examina werden modulbezogen abgelegt. Prüfungen werden so gestaltet, dass sie auch die Leistung von Studierenden bei den Qualitätsentwicklungen in der Praxis berücksichtigen.
7. Ausbildungseinrichtungen (auch solche, die nur einzelne Module anbieten) werden mit Praxiseinrichtungen zu regionalen Entwicklungsnetzwerken zusammengeführt.
Ausbildung ist für die qualitative Praxisentwicklung mit zuständig und wird darin auch evaluiert. Ein Teil der für Ausbildung vorgesehenen Mittel wird im Ergebnis einer solchen Evaluation leistungsbezogen vergeben. Infolge dieser Koppelung von Evaluation und Anreizen wird sich die Ausbildung stärker von Schulstandorten hin zu Praxisorten verlegen. Ausbilder werden stärker ambulant, d.h. mit Studierenden und Praxisvertretern vor Ort in Entwicklungsvorhaben arbeiten. Die bisherigen Ausbildungsstätte bleibt pädagogische Werkstatt, Ort der systematischen Reflexion, der Vor- und Nachbereitung, der Vermittlung praxisüberschreitender Wissensbestände.
8. Das Verhältnis zwischen den Lernorten wird innerhalb jedes Moduls dynamisiert.
Das Unterrichtsdeputat wird in modulbezogene Dienstzeiten an den jeweiligen Orten des Geschehens überführt. Vor- und Nachbereitungszeiten werden integriert.
Flexible Organisation und Unternehmensgeist
9. Die Ausbildungseinrichtungen erhalten eine weit reichende Autonomie in der Entwicklung ihres curricularen Profils, in der Ausgestaltung ihrer modulbezogenen Praxiszugänge, in ihrer Organisation sowie in Fragen der Personalbesetzung. Sie werden extern evaluiert.
Ausbildungseinrichtungen können, wenn sie Teil eines größeren Schulzentrums sind, eine kleine Schule in der großen bilden.
Innerhalb der Ausbildungseinrichtungen werden modulbezogene Teams aus Lehrenden und Studierenden gebildet, die in Verfolgung der mit dem Modul verbundenen Ziele und des zeitlichen Rahmens Gestaltungs- und Bewegungsfreiheit haben.
Die Ausbildungseinrichtungen sind berechtigt, sich unter Wahrung zu definierender Rahmenbedingungen Lehrkräfte selbst auszuwählen. Fachkräfte mit profilrelevanten Berufserfahrungen können ebenfalls eingestellt werden.
10 .Die Ausbildungseinrichtungen werden über Leistungsanreize angeregt, sich zu Community Schools weiterzuentwickeln.
Diese Entwicklung setzt drei Akzente: die synergetische Integration bisher getrennter, zur Profilbildung jedoch geeigneter Institutionen (wie z.B.: Kindertagesstätte, Kinderhotel, Jugendfreizeitheim, Schule, Volkshochschule, Beratungseinrichtungen, Restauration, Schülerfirmen), die Öffnung der Schule nach innen mit der Nutzung ihrer Ressourcen und der Entwicklung von Programmangeboten und Dienstleistungen für ein schulfremdes Klientel; die Öffnung nach außen mit der Erschließung von Lernorten und Handlungsfeldern in der Region.
11. Den Ausbildungseinrichtungen wird ermöglicht, zusätzliche Einnahmen zu erwirtschaften und sie im Rahmen ihrer gemeinnützigen Zwecksetzung zu verwenden. Öffentliche Zuwendungen erfolgen global und nicht an Einzeltitel gebunden.
Die Ausbildungseinrichtung kann finanzielle Prioritäten setzen. Mittel, die über eine Grundsicherung des Ausbildungsbetriebes hinausgehen, werden leistungsbezogen vergeben. Die Existenzgründungen Studierender sowie die Gründung von Schülerfirmen wird gefördert.
12. Für die staatliche Anerkennung einer privaten Ausbildungseinrichtung ist nicht deren Zugehörigkeit zu einem anerkannten Schulträger, sondern die extern evaluierte Qualität ihres Angebotes maßgebend. Die Umwandlung trägerabhängiger Ausbildungseinrichtungen in gemeinnützige Unternehmen wird ermöglicht.
Perspektiven der Weiterentwicklung flankierender Teilsysteme
Als Diskussionsanregungen seien hier noch einige Empfehlungen zu - von der Ausbildung her gesehen - flankierenden Teilsystemen abgegeben. Auch diese Empfehlungen sind den zuvor schon genannten Leitlinien - der Entwicklung von Qualitätsstandards für alle Teilsysteme, der externen, dialogischen und anreizgekoppelten Evaluation, dem sozial verträglichen Wettbewerb, dem Unternehmensgeist - verpflichtet.
Kindertagesstätten
13. Kindertagesstätten wird es ermöglicht, sich als Dienstleistungsunternehmen zu definieren und sich dazu eine geeignete Rechtsform zu geben (z.B. gGmbH, GbR).
Die Gründung von Kindertagesstätten ist nicht an eine Zugehörigkeit zu anerkannten Trägern gebunden. Eine vorläufige Betriebserlaubnis wird nach den Kriterien des KJHG (Bedarf) und nach Prüfung des vorgelegten, an Qualitätsstandards orientierten Konzepts erteilt. Der endgültigen Betriebserlaubnis geht eine externe Evaluation voraus. Kindertagesstätten erhalten die Möglichkeit, sich zu verselbständigen, ihre Träger zu kündigen oder zu wechseln.
14. Kindertagesstätten, die im Rahmen der Bestimmungen des KJHG arbeiten, erhalten garantierte Grundetats. Diese Beträge müssen ausreichend bemessen sein, um den Erziehungs- und Bildungsauftrag in mindestens befriedigender Weise erfüllen zu können (im Hinblick auf Qualitätsstandards, Personalschlüssel, Vor- und Nachbereitungszeiten, Aufnahme von Kindern unabhängig von ihrer sozialen Herkunft u.a.).
Kindertagesstätten, die in schwierigen Einzugsgebieten oder unter schwierigen Bedingungen arbeiten, erhalten einen erhöhten Grundbetrag. Es werden Anreize für Qualitätsverbesserungen geschaffen. Kindergärten, die sich einer externen Evaluation und einem ranking unterziehen, erhalten bei gutem Ergebnis in relevantem Umfang Leistungszuschläge, die sich sowohl im Bereich der Sachmittel als auch der Personalmittel auswirken.
Kindertagesstätten erhalten Haushaltsautonomie. Sie unterliegen einem externen Controlling.
15. Kindertagesstätten werden ermutigt, sich durch Community Business, d.h. durch Differenzierung und Erweiterung ihres Dienstleistungsangebotes, Mittel selbständig zu erwirtschaften.
Sie unterliegen dabei Rahmenbedingungen, die sich aus ihrer jugend- und bildungspolitischen, gemeinnützigen Zielsetzung ableiten. Kindertagesstätten haben das Recht auf Gründung von Subunternehmen.
Eltern
16. Die bisherige Definitionsmacht der Jugendhilfe-Verwaltung, welches institutionelle Angebot für Eltern und Kinder angemessen sei, wird weitgehend an die Eltern und Erzieherinnen abgetreten, wobei die Grenzen dort gesetzt sind, wo gegen den Grundsatz der Kindgemäßheit verstoßen oder Qualitätsstandards deutlich unterschritten werden.
Nicht nur die von Trägern oder Erzieherinnen, sondern auch die von Eltern gegründeten Einrichtungen unterliegen hinsichtlich fachlicher Standards der Evaluation.
Träger
17. Träger sind Dienstleistungsunternehmen, die Praxiseinrichtungen bei der Entwicklung fachlicher Qualität, eines besonderen Profils, der lokalen, regionalen und überregionalen Vernetzung, des Management, der Unternehmensentwicklung und des Marketing unterstützen.
Ihre Angebote werden durch die Nutzer geprüft, verhandelt, akzeptiert oder zurückgewiesen.
18. Träger unterliegen hinsichtlich ihrer fachlichen Qualität auf allen Ebenen, insbesondere der lokalen, einer externen, dialogischen Evaluation.
Die Vergabe von öffentlichen Mitteln wird zum Teil an die Ergebnisse einer solchen Evaluation geknüpft; die Träger werden hinsichtlich allgemeiner - nicht: trägerspezifischer - Qualitätsstandards in ihren Einrichtungen einem Ranking unterzogen.
19. Neuen Trägern ist der Zugang zu erleichtern.
Sie unterliegen der externen Evaluation und einer daran geknüpften Mittelvergabe.
Fachaufsicht
20. Die trägerinterne wie trägerübergreifende Fachaufsicht wird in ein System externer, an Qualitätsstandards orientierter Evaluation überführt.
Berufsbild und -perspektiven
21. Es werden Kinder- von Jugend- und Erwachsenenpädagog/inn/en unterschieden. Die Tätigkeiten von Kinderpädagog/inn/en bezieht sich auf die Altersgruppe der Null- bis Vierzehnjährigen.
Der Tätigkeitsbereich wird differenziert und so ausgelegt, dass eine ganzheitliche Förderung und Betreuung von Kindern inner- und außerhalb von Institutionen möglich wird. Auch wenn der Akzent auf Pädagogik liegt, bezieht die berufliche Tätigkeit angrenzende Gebiete - wie die der psychosozialen Versorgung, der Gesundheitsvorsorge, der Familienpolitik, der Ökonomie, der Lernbereichsdidaktik - mit ein. Der Beruf wird in seiner tariflichen Struktur neu bewertet. Kinderpädagog/inn/en im Angestelltenverhältnis werden analog zu Grundschullehrer/innen vergütet. Die Tendenz zur selbständigen Niederlassung wird gefördert. Wechsel und Aufstieg innerhalb des beruflichen Tätigkeitsrahmens werden gefördert und honoriert. Solche Veränderungen können in Anlehnung an das von der OECD seinerzeit empfohlene Modell der recurrent education angelegt werden (an materielle und sonstige Anreize geknüpfter Wechsel von Ausbildung / Berufspraxis / Weiterbildung / Berufspraxis / Weiterbildung / Berufspraxis - wobei relevant ist, dass die sich qualifizierende Person durch solche Anreize dem beruflichen Praxisumfeld erhalten bleibt).
Kindheit als Gegenstandsbereich
22. Kindheit (mit der Altersspanne null- bis vierzehnjähriger Kinder) wird als fach-politisch eigener Gegenstandsbereich gefasst und einem, nicht zwei Ressorts zugeschlagen, das die jugend- und bildungspolitische Zuständigkeit in sich vereint.
23. Die Ausbildung von Kinderpädagog/inn/en und Grundschulpädagog/inn/en erfolgt in Teilen nach einem sozialpädagogisch orientierten Curriculum, in dem die gemeinsamen Kennzeichen vor-, außer-, und schulischer Bildung und Erziehung herausgearbeitet werden.
Dazu gehören beispielsweise: Situations- und Lebensweltbezug bei Bildungsprozessen, entdeckendes und projektorientiertes Lernen, Verbindung von sozialem und sachbezogenem Lernen / Lernbereichs- statt Fächerorientierung, Elternmitwirkung, offene Planung / offener Unterricht, Gemeinwesenorientierung / Community Education u.a.m.
24. Die institutionelle Verortung jeweiliger Teileinrichtungen (Krippe, Kindergarten, Hort, Grundschule) wird dadurch zweitrangig, dass die genannten Einrichtungen (neben ihren je spezifischen) auch an gemeinsamen Qualitätsmerkmalen gemessen und evaluiert werden.
Integrative Formen - die ganztägige, kindgemäß rhythmisierte Grundschule in der Form einer Nachbarschaftsschule zum Beispiel - sind additiven Formen - Grundschule neben Hort - vorzuziehen.
Soweit diese Vorschläge. Darüber kann man streiten. Streit ist besser als Resignation.
Auf zwei Verbündete sei hier verwiesen: auf die neue "Rahmenvereinbarung zur Ausbildung und Prüfung von Erziehern/Erzieherinnen", beschlossen von der Kultusministerkonferenz am 28. Januar 2000, und auf die Studie von Beher/Hoffmann/Rauschenbach (1999).
Der KMK-Beschluss stellt einen Bezugsrahmen her, der sinnvolle Eckwerte setzt, der wichtige Ziele und Lernbereiche benennt. Dieser Beschluss folgt unseren Überlegungen ein gutes Stück weit, schafft Klarheit über den Pflichtteil der Ausbildung und erleichtert eine profilbildende Kür.
Die Studie von Beher/Hoffmann/Rauschenbach wiederum weist nach, dass die dramatischen Veränderungen der Berufschancen und -anforderungen von Erzieherinnen eine Neuorientierung der Ausbildung nahezu erzwingen. Bertolt Brecht hat gesagt, die Zukunft beginne nicht überall zur gleichen Zeit. So auch hier. Die Idylle lebt (noch) weiter, nebenan breitet sich schon Erschrecken aus. Deutlich wird, dass der Wettbewerb in den Teilsystemen rings um die Tagesbetreuung längst eingesetzt hat. Nur Lemminge trotten Abgründen ahnungslos entgegen. Besser sind die Düsentriebs dran. Sie knipsen ihre Phantasie an und erfinden Brücken, die zum anderen Ufer führen. Die Mühen der Ebene liegen allemal vor uns.
5. Ausblick
Der Situationsansatz ist aus einer theoriegeleiteten wie praxisverbundenen Diskussion entstanden. Er hat viel Zustimmung gefunden, vor allem aber ein hohes Maß an pädagogischer Phantasie und Praxis freigesetzt. Es besteht kein Anlaß, die Lichter, die von vielen tausend Erzieherinnen entzündet wurden, gering zu schätzen und unter den Scheffel zu stellen.
Gleichwohl bedarf er der Weiterentwicklung und Fundierung. Wissenschaftspolitisch ist damit gemeint, das Verhältnis von research & development, von Entwicklung, Implementation und grundlagenorientierten Studien besser zu balancieren. Zu den von Kritikern nicht berücksichtigten Rahmenbedingungen, unter denen der Situationsansatz entwickelt wurde, gehört, daß die Modellversuchspolitik der vergangenen drei Jahrzehnte komplementäre, grundlagenorientierte Studien nicht auf der Prioritätenliste hatte. Der Situationsansatz ist in überwiegendem Maße durch Wissenchaftler/innen und Moderator/inn/en auf zeitlich eng befristeten, drittmittelfinanzierten Stellen entwickelt und evaluiert worden. Projektmitarbeiter/innen waren schon aus Gründen der Existenzsicherung nicht in der Lage, sich anschließend in die Rolle von Privatgelehrten zurückzuziehen und offenen Fragen vertiefend nachzugehen.
Bemerkenswert ist nun, daß einige der Kritiker auch auf akademisch sicheren Posten der Kindergartenreform nicht zugearbeitet, reklamierte Aufgaben nicht selbst gelöst, eigene bessere Konzepte nicht vorgelegt und implementiert haben. Immerhin hatten sie dreißig Jahre Zeit dazu. Wo ist denn – jenseits der interessanten Nischen Waldorf, Montessori oder Reggio - die von der deutschen Kritik vorgelegte überzeugende Alternative, die alle die offenen Fragen beantwortet? Wo ist die Anthropologie des Kindes und wo das umfassende Programm, das entwicklungs- und kognitionspsychologische sowie lerntheoretische Erkenntnisse moderner Art der Praxis erschließt? Blickt man in die heterogene Landschaft von Praxiseinrichtungen, wird deutlich, daß dem Situationsansatz – in gradueller Abstufung – nach wie vor eine Frühling-Sommer-Herbst-und-Winter-Pädagogik gegenübersteht. Es genügt nicht, Qualität zu messen. Man muß sie vorher entwickeln.
Anders als andere Ansätze – man nehme als Beispiel das Gefälle zwischen der vorzüglichen Reggio-Pädagogik und der Praxis in übrigen italienischen Kindergärten - hat der Situationsansatz national in die Breite gewirkt. Er hat Wahlverwandte gefunden und trifft sich mit modernen Formen der Erwachsenenbildung, der betrieblichen Ausbildung, der Micro Entrepreneurship Education, der Community Education, der Orientierung des Unterrichts an Klafki’schen epochalen Schlüsselthemen, mit Formen des fächerübergreifenden, handlungs- und lebensweltorientierten Lernens. Er will seinen Bildungsanspruch in einem sozialpädagogischen Umfeld hochhalten, sich gegen Verschulungstendenzen wehren, Tendenzen der Rückkehr zu Funktionstrainingsprogrammen widerstehen, seine Offenheit (die nicht Beliebigkeit ist) gegen zu zwanghafte Strukturierungsversuche verteidigen, zwischen wissenschaftlichem Wissen und Erfahrungswissen vermitteln, den Diskurs nicht durch das Kommuniqué ersetzen, das Kind im Mittelpunkt belassen. Zugleich braucht er eine intensive Anbindung an die Humanwissenschaft, bedarf der weiteren didaktischen Differenzierung und prägnanteren Fassung zentraler Begriffe: Dies ist ein attraktives Programm für die nähere Zukunft. Wenn sich aus den Arbeiten des Entwicklungspsychologen Daniel N. Stern schlußfolgern läßt, daß die reale, anregungsreiche Situation ein wichtiges Ferment der Selbst-Entwicklung des Kindes ist, daß die Provokation des lernintensiven Milieus bildet, wenn Albert Bandura davon spricht, daß positive Auffassungen der persönlichen Handlungskompetenz zum ‚wirksamen‘ Verhalten in Situationen beitragen können, dann treffen sich solche Aussagen nicht nur mit dem Situationsansatz, sondern auch mit einer Beobachtung von Ivan Illich: Das meiste Lernen, meinte er, geschehe nicht durch Unterricht, sondern durch die ungehinderte Teilhabe an relevanter Umgebung.
Literatur
Beher, K./Hoffmann, Hilmar/Rauschenbach, Thomas: Das Berufsbild der ErzieherInnen. Vom fächerorientierten zum tätigkeitsorientierten Ausbildungskonzept. Neuwied 1999.
Damerow, Peter et al.: Elementarmathematik: Lernen für die Praxis? Ein exemplarischer Versuch zur Bestimmung fachüberschreitender Curriculumziele. Mit Einführungen von Karl Peter Grotemeyer und Carl Friedrich von Weizsäcker. Stuttgart 1974.
Delphi-Befragung 1996/1998: "Potentiale und Dimensionen der Wissensgesellschaft - Auswirkungen auf Bildungsprozesse und Bildungsstrukturen". Abschlußbericht zum "Bildungs-Delphi", Integrierter Abschlußbericht, Endbericht. München 1998.
Doyé, Götz/Lipp-Peetz, Christine: Das soll einer verstehen! Wie Erwachsene und Kinder mit Veränderungen leben. Praxisreihe Situationsansatz, Weinheim 2000.
Jain, Manish: Towards Open Learning Communities: One Vision under Construction. UNESCO, Paris 1997.
Keitel, Christine: Prejudices and Presuppositions in the Psychology of Maths Education. Plenary lecture PME 10. In: Proceeding of PME 10, London University Institute of Education, London 1986.
Klafki, Wolfgang: Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemäße Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik. 5. Aufl., Weinheim 1996.
Klafki, Wolfgang: „Schlüsselprobleme“ in der Diskussion – Kritik einer Kritik. In: Neue Sammlung, 38.Jg., 1998, H.1, S.103-124.
Krüger, Angelika/Zimmer, Jürgen: Die Ausbildung der Erzieherinnen neu erfinden. Neuwied/Berlin 2001.
Wolf, Bernhard/Becker, Petra/Conrad, Susanna/Jäger, Siegfried: Macht sich "Kindersituationen" bei Kindern bemerkbar? Der Situationsansatz in der Evaluation. In: Empirische Pädagogik, Jg. 12,1998, H.3, S. 271-295.
Wolf, Bernhard/Becker, Petra/Conrad, Susanna (Hrsg.): Der Situationsansatz in der Evaluation. Ergebnisse der Externen Empirischen Evaluation des Modellvorhabens "Kindersituationen". Landau 1999.
Wolf, Bernhard/Hippchen, Gisela/Struck, Andrea: Und sie haben doch etwas bewegt. Auswirkungen von „Kindersituationen“ vier Jahre danach. In: Empirische Pädagogik, Jg.15, 2001, H.3, S.429-454.
Wolf, Bernhard/Stuck, Andrea/ Roux, Susanna/Lindhorst, Heiko/Hippchen, Gisela: Erhebungsmethoden in der Kindheitsforschung, Aachen 2001.
Zimmer, Jürgen./Preissing, Christa/Thiel, Thomas/Heck, Anne/Krappmann, Lothar: Kindergärten auf dem Prüfstand. Dem Situationsansatz auf der Spur. Seelze-Velber 1997.
Zimmer, Jürgen: Das kleine Handbuch zum Situationsansatz. Praxisreihe Situationsansatz, Ravensburg 1998.
Zimmer, Jürgen: Der Situationsansatz in der Diskussion und Weiterentwicklung. In: Fthenakis, Wassilio/Textor, Martin (Hrsg.): Pädagogische Ansätze im Kindergarten, Weinheim 2000, S.94-114.
"Nicht das Rad neu erfinden." Quelle: Diskurs, H.2, 2002, S. 11-18